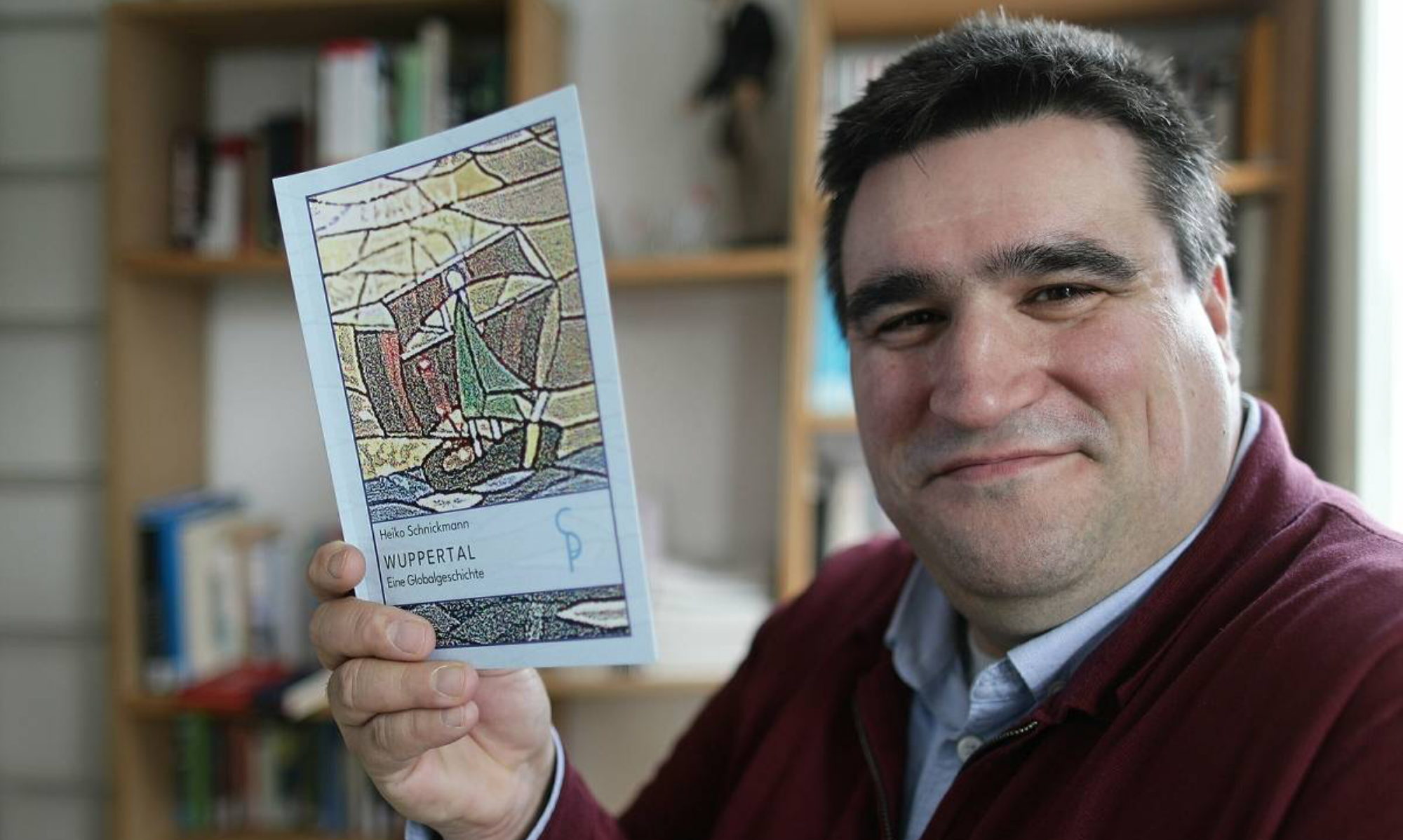Wer probiert eine Definition dessen zu finden, was Rassismus ist, wird, wenn er fünf Bücher aufschlägt, fünf Definitionen finden. Der Begriff selber wird erstmals 1933/34 in einem Buch von Magnus Hirschfeld erwähnt, das Rassismus heißt. Darin gibt es interessanterweise keine Definition des Begriffs.
Der Begriff wird genutzt, um sich kritisch mit der Rassenlehre auseinanderzusetzen. Erst mit Ruth Benedict 1942 gibt es erstmals eine Definition von Rassismus. Sie bezeichnet Rassismus als
das Dogma, das eine ethnische Gruppe von der Natur zu angeborener Unterlegenheit verdammt, eine andere dagegen zu angeborener Überlegenheit auserkoren ist.
Wichtig an dieser Definition ist vor allem die Tatsache, dass klar darauf abgezielt wird Unterschiede zwischen Menschen aufzuzeigen, die durch die ethnische Zugehörigkeit bestimmt sind. Eine Gruppe ist überlegen, eine nicht. Eine ist clever, eine andere nicht, eine ist lustig, eine andere nicht, eine Gruppe ist produktiv, die andere faul.
Wenn es eine solche Unterteilung aber gibt, die einzig alleine darauf beruht, dass Rasse, Ethnie oder DNS bestimmen, wie jemand ist, dann haben Umweltfaktoren keinen Einfluss auf das Verhalten. Oder wie es schon Immanuel Kant formulierte:
dieser Kerl war vom Kopf bis auf die Füße ganz schwarz, ein deutlicher Beweis, daß das, was er sagte, dumm war
Was der Königsberger Aufklärer uns damit sagen wollte ich wohl klar: Wenn ein Argument von einem Schwarzen komme, sei es nichts wert, denn es komme von einem Dummkopf. Lernen ist demnach wohl nicht möglich, zumindest nicht ein tiefer gehendes, auch wenn an der Oberfläche mal das ein oder andere beeindruckt. Der schottische Philosoph David Hume, seines Zeichens Vertreter der Empiriker, etwa fasst, nachdem er darauf aufmerksam gemacht worden war, dass es es in der Karibik eine Schule gebe, die von einem gebildeten Schwarzen betrieben würde nur fest, dass dieser Mann
für geringe Leistung gelobt [wird], wie ein Papagei, der ein paar Worte fehlerfrei aufsagt.
Es gibt aber auch andere Arten von Rassismus. Der amerikanische Historiker Ibram X. Kendi unterteilt Rassismus in zwei Unterarten, die er beide ablehnt. Zum einen spricht er von Assimilationismus. Darunter versteht er, dass man von einer als untergeordnete empfundenen Rasse verlangt, dass sie sich der obergeordneten Rasse anpasst bzw. die obergeordnete Rasse hilft der anderen bei diesem Aufschließen. Zum zweiten spricht er von Segregationismus, was wiederum bedeutet, beide identifizierten Rassen sollen von einander getrennt werden und sind schlicht ungleich, eine steht höher, eine weiter unten. Diese Definition nutzt Kendi um in seinem Buch „Gebrandtmarkt“ die Geschichte des Rassismus in den USA aufzuzeigen.
Vor allem die erst genannte Unterart von Rassismus widerspricht der von Ruth Benedict gegebenen Definition der Bedingungslosigkeit. Denn entweder ist man genetisch-rassistisch bedingt determiniert oder man hat die Möglichkeit zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Beides aber geht nicht.
Warum ist eine Definition von Rassismus wichtig? Wer nicht zwischen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit unterscheidet, der hat ein Problem. Fremdenfeindlich kann man nämlich immer sein, so lange man bereit ist, zu lernen, dass ein Fremder nicht unbedingt ein Feind ist. Wer ein Rassist im Sinne von Ruth Benedict ist, der ist genau dazu nicht bereit, denn das bedeutet, der Fremde kann in seinen Augen niemals Teil dessen sein, was er nicht als fremd ansieht.
Der Gegensatz zwischen dem Eigenen und dem Fremden ist übrigens die Krux an der ganzen Debatte. Als Mensch bin ich immer nur Herr über meine eigenen Gedanke und Gefühle. Ich kann durch Empathie probieren, mich in andere hineinzuversetzen, aber gelingen wird niemals zu hundert Prozent. Außerdem zeigt dies auf, dass Rassismus einen Dualismus beinhaltet. Es gibt mich und es gibt die anderen.
Ich habe Erwartungen an die anderen, die anderen haben Erwartungen an mich. Wenn mir etwa vor Augen geführt wird, dass ein bestimmter Begriff aus guten Gründen nicht gewählt werden darf, weil die anderen sich durch diesen Begriff als Mensch herabgesetzt fühlen, wird der Begriff nicht mehr gebraucht. Das ist sehr einfach, wenn es darum geht, mit einzelnen Menschen umzugehen. Dumm ist halt nur, dass einzelne Menschen immer auch Teil irgendeiner Gruppe sind. Teil einer Familie, einer Stadt, eines Landes, eines Kontinents, einer Ethnie, einer Berufsgruppe. Es macht Spaß sich über die anderen lustig zu machen. Handwerkerwitze, Beamtenwitze, Holländerwitze, Sprüche über die Fahrweise von Autofahrern aus einer bestimmten Region. Das gehört dazu. Für diejenigen, über die man Witze macht, ist das nicht immer lustig. Wahrscheinlich kann kein Beamter mehr den xten Witz über seine Faulheit ertragen, kein Holländer mehr einen Witz über einen Wohnwagen oder ähnliches. Das ermüdet. Es ist nervig, aber irgendwie kommt deswegen durch den Tag.
Was also ist das Problem mit Witzen über gesellschaftliche Minderheiten? Warum kein Witz über einen Rollstuhlfahrer, Frauen oder Juden (oftmals haben diese Gruppen ja eh die besten Witze über sich selbst im Kopf und können sich so im besten Sinne des Wortes selbst verarschen!) Ralph Ruthe erklärte auf Twitter das einmal am Beispiel eines afro-deutschen Bekannten, der ihn darauf hinwies, dass dieser Angst vor Skinheads hätte. Daraufhin schrieben viele Skinheads (die Szene ist, wenn ich mich richtig erinnere ursprünglich links-anarchistisch geprägt gewesen, bevor die rechte Szene das aussehen übernahm), das diese Angst unbegründet sei und gingen zum Teil sogar soweit, zu behaupten, dass auch die Angst des Freundes ja ein Vorurteil sein. Ruthe antwortete darauf nur, dass man sich den Stil aussuchen könne, die Hautfarbe aber nicht.
Soll heißen, wenn du nicht willst, dass man dich aufgrund deines Kleidungsstils als rechts bezeichnet, auch wenn du es gar nicht bist, wechsle deinen Kleidungsstil und fertig ist die Laube. Haut abziehen, um nicht mehr als Schwarzer erkannt zu werden, ist aber eben nicht möglich.
Recht hat er, oder? Eben nicht. Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist wichtig für die Identität eines Menschen. Wenn ich mich zu einer Gruppe zugehörig fühle und es mich glücklich macht, dieses Zugehörigkeitsgefühl durch Kleidung, Frisur oder Make-up nach außen zu zeigen, so bedeutet der Verzicht darauf einen Einbuße an persönlichem Glück.
Natürlich kann man sagen, dass das Sicherheitsgefühl anderer Mitbürger höher zu hängen sind als das persönliche Glück, aber wenn dieses Sicherheitsgefühl eine tagtägliche Einschränkung bedeutet, ist das ein großes Problem. Ein Angehöriger einer linken Skinheadgruppe, soll, weil die Gefahr besteht, dass ihm ein Mensch über den Weg läuft, der Angst vor ihm hat, einen Teil seiner Identität aufgeben, weil es sich dabei um eine selbst gewählte Identität handelt? Er kann natürlich darauf verzichten, wenn er davon ausgehen kann, dass er Menschen trifft, die Angst haben könnten. Aber sollte er immer davon ausgehen und deswegen auf diesen Teil seiner Identität verzichten? Woher soll er denn Wissen, dass der Migranten, der gerade an ihm vorbeigeht, ein Angstgefühl hat? Dazu weiß er doch gar nicht über die Person. Der Migrant müsste zum Beispiel wissen, das schwarze Springerstiefel und weiße Schnürbänder ein Zeichen für Skinheads sind, dass diese Skinheads oftmals zur rechten Szene gehören usw. Ein Mensch, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt und genug Probleme damit hat, sich in die Behördenstruktur und das öffentliche Leben eines Landes einzuarbeiten, während er gleichzeitig um Teile seiner Familie bangt und Deutsch lernt, wird wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen tatsächlich Zeit finden, sich in die Feinheiten der Subkultur des Rechtsextremismus einzuarbeiten.
Anders sieht das für jemanden aus, der in Deutschland geboren und/oder aufgewachsen ist. Der kennt die Symbolik der Glatze, der Bomberjacke und Stiefel sehr wohl, wenn auch nur als Zeichen für rechts, denn niemand hat wirklich Zeit sich in die Feinheiten dieser ganzen Subkulturen einzuarbeiten.
Der Mensch, der vor dem Verlassen seiner Wohnung sich entscheidet, ob er sich heute zu seiner selbstgewählten Gruppenidentität bekennt oder nicht, der soll einfach davon ausgehen, dass jemand vorbei kommen könnte, dem er Angst macht? Das ist eine Einschränkung persönlicher Lebensentfaltung aus Rücksichtnahme auf einer andere Gruppe. Der öffentliche Raum ist ein Raum für alle. Man muss damit leben, Menschen zu begegnen, die man unsympathisch findet, die einem Angst machen können, genauso wie man damit rechnen muss, vielleicht die Liebe seines Lebens in der U-bahn zu treffen oder ein bekanntes Gesicht, das man schon lange nicht mehr gesehen hat.
Trotzdem ist der öffentliche Raum ein geschützter Raum. Zwar muss ich damit rechnen, dass ich unheimliche Menschen oder Menschen sehe, die ich an bestimmten Orten nicht sehen will, doch muss ich nicht damit rechnen, dass diese unsympathischen Menschen mich angreifen, mich beleidigen oder bestehlen. Das kann alles passieren, aber im Rechtsstaat wird solch ein Vorgehen normalerweise geahndet (vorausgesetzt, es gibt genug Polizisten, Staatsanwälte und Richter, was es in Deutschland in vielen Teilen nicht mehr gibt). Dafür gibt es Gesetze, dafür gibt es Gerichte und sogar Strafen. Wofür es so etwas nicht gibt, ist dafür, dass jemand Angst bekommt, wenn er jemanden sieht, der ihm nicht gefällt, selbst wenn es gute Gründe gibt, dass er Angst haben kann.
Das sieht natürlich anders aus, wenn man jemanden ganz bestimmten sieht, etwa den Nachbarn, der einen schon einmal angegriffen hat, die Ex, die einen immer geschlagen hat und vieles mehr. Hier gibt es eine Angst, die sich auf ein Individuum bezieht, eine Angst vor Menschengruppen, ist aber eben nichts, vor dem man sich schützen kann, wenn man sich in der Straßenbahn, der Fußgängerzone oder am Flussufer aufhält. Diese Angst muss man aushalten können, man kann sie kompensieren oder umlenken oder in der Therapie besprechen, aber man kann nicht erwarten, dass alle anderen Menschen davon ausgehen, dass dem Typen, der einem im Bus gegenüber sitzt, gerade Angst und Bange wird, weil man sich entschlossen hat, seinen selbst gewählten Lifestyle zur Schau zu tragen.
Was hat das jetzt mit Rassismus zu tun? Was alle Definitionen von Rassismus gemeinsam haben, ist dass ein Individuum aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit definiert wird und nicht als das Individuum, das es ist. Menschen haben bestimmte Bilder von anderen Menschen im Kopf. Man hört ein bestimmtes Wort und ein Stereotyp oder Vorurteil zu Menschen taucht auf. Dieses Bild ist geprägt durch eigene Erfahrungen, Medien, Schule, Gespräch mit anderen, kulturelle Eigenarten und vieles mehr. Dieses Auftauchen von Stereotypen ist, so denke ich, eine anthropologische Grundkonstante. Gegen dieses Auftauchen kann man nichts machen. Solche Bilder entstehen. Was man machen kann, ist das Bild im Kopf zu ändern. Dazu braucht es Informationen, Umgang, eigene positive Erfahrungen und vieles mehr.
Wenn also nun ein Mensch, der all diese Erfahrungen und Information nicht hat, öffentlich ein Statement über eine Gruppe von Menschen äußert, zu denen er keinerlei Beziehung hat, von denen er aber dennoch ein Bild im Kopf hat. Wer dieses Bild wenig vorteilhaft für die bezeichnete Gruppe ist, dann ist die Aussage dumm und, wenn es sich bei dieser Gruppe um etwa um eine fremde Ethnie handelt, auch rassistisch. Aber ist deswegen derjenige, der die Aussage tätigt auch ein Rassist oder einfach ein Mensch, der zum Zeitpunkt der Aussage zu wenig Informationen oder auch keine Zeit oder auch einfach keine Lust für eine intensive Recherche?
Natürlich kann man nun sagen, wenn er dafür keine Zeit und Lust hat, soll er sich nicht äußern, aber dann sind wir bei einem ganz anderen Problem, nämlich der Frage, ob, wenn ich mich äußere, etwa im Vortrag, Interview oder bei einer politischen Wahl, ich mich vorher immer ordentlich vorbereiten muss oder ich, weil ich das nicht kann, meine Äußerung sein lasse, also eventuell nicht wählen gehe. Wer keine Ahnung hat, soll seine Meinung, die auf nichts fußt außer seiner Intuition, nicht mehr äußern dürfen? Das klingt mir nicht nach einem sehr demokratischen Konzept.
Nein, seine Meinung zu äußern, und wenn sie noch so blöd ist, ist ein Grundrecht. Ich darf niemanden persönlich beleidigen, ich darf nicht dazu aufrufen, jemanden oder eine Gruppe zu töten. Das sind die Einschränkungen, alles andere muss eine demokratisch verfasste Gesellschaft aushalten und zwar nicht nur die Gesellschaft, auch jedes einzelne Individuum.
Dazu gehört auch eine rassistische Äußerung. Vollkommen absurd wird es dann, wenn Menschen einfordern über Rassismus diskutieren dürfe nur, wer ihn erlebt. Das ist mit Verlaub, ein großer Blödsinn. Warum sollten nicht auch die darüber diskutieren dürfen, die ihn ausüben? Das eine ist so gut, wie das andere. Das Problem ist, dass es so schön einfach ist, die Seite des Opfers einzunehmen, denn das opfer hat moralisches Oberwasser, es hat unser Mitleid. Der Täter hat es nicht. Es gibt einen Grund, warum Rechtsanwälte probieren, die Hintergrundgeschichte eines Angeklagten zu erzählen und diesen dann zu einem Opfer von Umständen machen, die ihn zum Täter werden ließen. Das Mitleid mit einem Opfer, ist immer positiv. Ein Opfer nach einer Tat zu belasten, es für die Tat selber verantwortlich zu machen, geht nicht und wird zu recht moralisch angekreidet. Es ändert aber nichts daran, dass Moral eben nur ein Aspekt in einer gesellschaftlichen Debatte ist und nicht unbedingt der entscheidende.
Das Opfer hat nicht immer Recht, schon alleine deswegen, weil Opfer und Täter rein rechtlich erst nach einem Richterspruch zu identifizieren sind. Grundlage eines solchen Richterspruches ist immer der Täter, niemals das Opfer. Das ist eine 2000 Jahre alte Errungenschaft – im Zentrum eines Prozesses steht der Angeklagte, nicht das Opfer. Im Zweifel eben für den Angeklagten, der Ankläger muss beweisen, dass er Recht hat.
Wie aber beweist man, dass jemand Rassist ist und nicht nur eine unbedachte rassistische Äußerung getan hat? Man schaut, was der Mensch so macht und sagt. Gibt es da keine Unauffälligkeiten, dann ist alles gut. Es sei denn man legt die Schwelle so hoch, dass die Aussage alleine jemanden zum Rassisten macht. Kann man machen und manchmal hat man das Gefühl, dass viele vor allem auf Twitter gerne tun, allein: Was tut man dann? Da erzählt jemand etwas Dummes und wird zum Rassist. Aber der, der Dummes erzählt, sieht sich gar nicht als Rassist, schon gar nicht, wenn man ein Deutscher ist, denn dann ist man nicht nur Rassist, sondern auch Nazi, also einer von denen, die 6 Mio. Juden umgebracht haben, das schlimmste Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Das ist man dann, wenn man kurz darauf hinweist, dass die Romafamilie nebenan mehr Dreck macht, als normal ist? Man ist ein Massenmörder, ein Nazi, Hitler-Fan? All das schwingt als Bild mit im Kopf, wenn man das Wort Rassist hört. Und derjenige, der das Wort zur Bezeichnung eines anderen benutzt, der weiß das auch. Er nutzt das Wort als moralisches Argument, um den Diskurs zu gewinnen, um als Sieger vom Platz zu gehen.
Wundert es dann, wenn Menschen sagen: Okay, ich bin Rassist, ich bin Nazi, aber dann kann ich wenigstens sagen, dass die Romafamilie nebenan endlich ihren Müll ordentlich entsorgen soll. Und wenn die das nicht tut und mir vielleicht sogar Ärger androht, dann wähle ich halt die AfD. Die wird sich schon darum kümmern.
Und merken Sie es: Auf einmal ist der Rassist in diesem kleinen Narrativ zum Opfer derjenigen geworden, die ihn Rassisten nennen. Und so haben wir auf einmal einen Opferdiskurs. Daran nehmen Menschen teil, die sich bedroht fühlen und Menschen die wirklich bedroht wurden, es nehmen Menschen teil, die genervt sind nach der Frage ihrer Herkunft und diejenigen, die genervt sind, weil man nicht mal mehr fragen darf, woher jemand kommt, ohne als Rassist beschimpft zu werden. Alles Opfer der Umstände, alle gleich wichtig, Alles Quatsch.
Ich hasse diesen Opferdiskurs. Alle wollen im Diskurs das Opfer sein, damit sie die moralische Karte spielen können. Denn gegen Moral kann man nicht argumentieren, Moral und die eigenen Gefühle sind so wichtig und das einzige, was man nutzen sollte, um … ja, um was eigentlich. Als Sieger vom Platz zu gehen, um sich besser zu fühlen? Das wirklich Leben ist kein dauerhafter Glückszustand. Es ist geprägt von Ärger, Angst und Hass. So lange sich all das nicht in Taten äußert, die Menschen ernsthaft verletzen und nicht nur gefühlt, so lange ist alles gut. Werdet Erwachsen und wenn es zu schlimm wird: Es gibt gute Ärzte, die helfen können. Die ändern aber nicht die Gesellschaft, die suchen die Lösung bei euch!
So bleibt nur noch eine Frage: Was ist jetzt mit Rassismus? Die Debatte, wie sie zurzeit geführt wird, immer wenn etwas passiert, ist saublöd, egal ob sich Journalisten, Wissenschaftler, Betroffene oder Täter beteiligen. Sie geht immer nur davon aus, das es Menschen gibt, die sich getroffen fühlen. Sie moralisiert und hinterlässt nur Verlierer und neue Opfer. Das ist nicht hilfreich. Was wirklich wichtig ist, ist Aufklärung (auch wenn Kant und Hume gerade als Negativbeispiele angeführt wurden)! Aufklärung über Stereotypen, Aufklärung über Psychologie, Aufklärung über Sprachbilder, Aufklärung über Geschichte und Philosophie des Rassismus. Das kann nicht die Schule leisten. Da ist Weiterbildung gefragt, politische Erwachsenenbildung. Aber diese dümpelt vor sich hin. Berufsfördernde Bildung boomt, humanistische wird verlangt, wird aber kaum gedeckt. Da muss angesetzt werden. Alles andere führt zu Murks und Quatsch. Öffnet die Universitäten für alle Interessierten, fördert die Volkshochschulen, gebt Angestellten die Möglichkeit, sich politisch und persönlich zu bilden und verzichtet auf die Moral als Argument. Und niemand mehr wird dumm dahinquatschen.