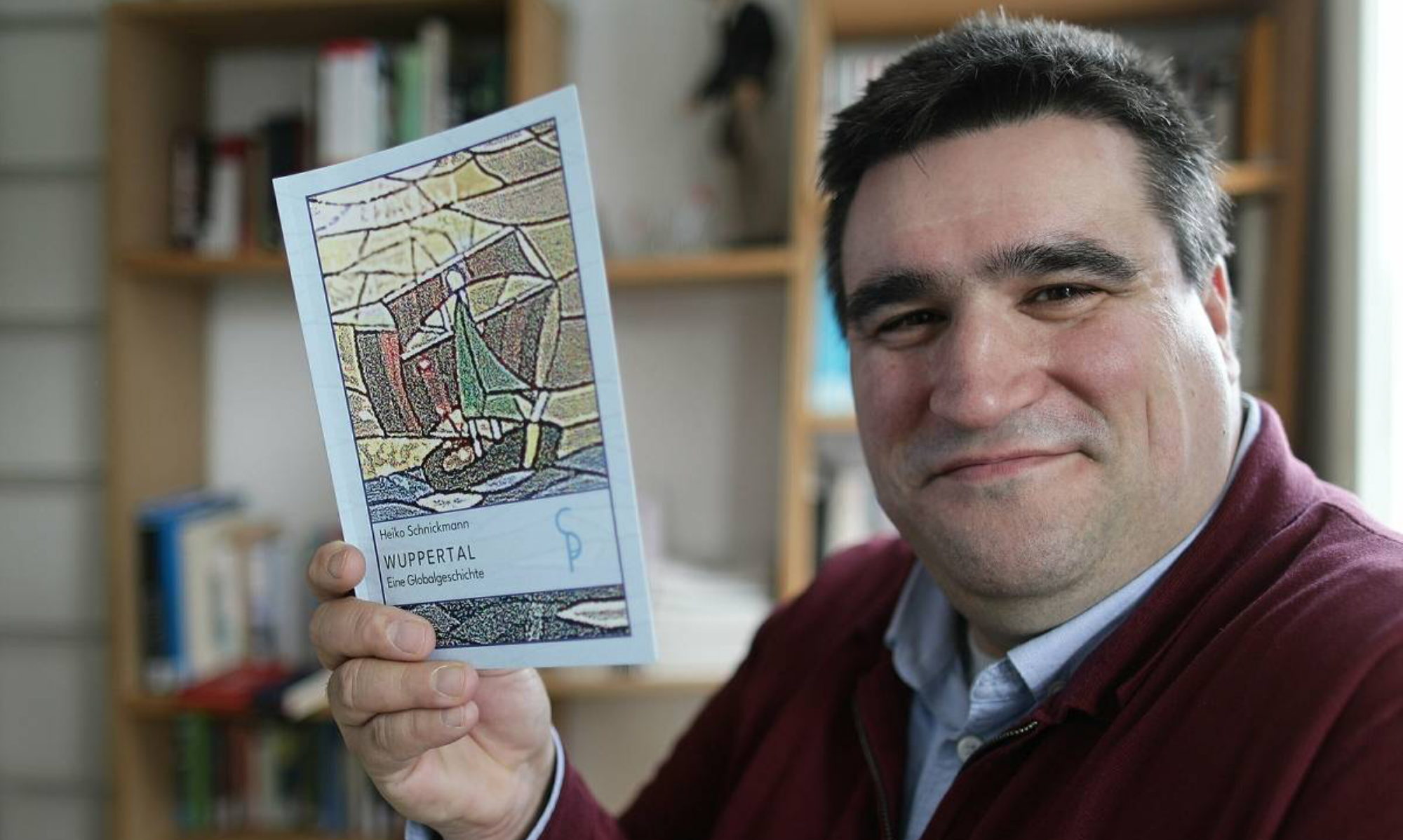Wer schon einmal davon gehört hat, dass es so etwas wie ComicCons gibt, also Veranstaltungen, in denen es um Figuren geht, die man aus Fernsehen, Film und Comic kennt, der wird sich mit Verwunderung die Augen darüber reiben, einen Text zu lesen, in dem es, um das Phänomen des Postheroischen gibt. Dort laufen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsen, die jung geblieben sind, in Kostümen herum, um ihren Helden nahe zu sein. Es wimmelt dort von Super-, Fledermausmännern und auch immer mehr von Batgirls, Wonder Women und anderen Figuren.
Es wäre ein Leichtes darin vor allem ein Juvenalisierung der Gesellschaft, eine Verjüngung zu sehen. Nicht mehr das Alter ist das Erstrebenswerte, sondern das ewige Jungsein. Und vielleicht ist da auch etwas dran. Kinder brauchen Helden. An ihnen können sie sich orientieren, sie geben ihnen eine Richtung vor, in die sie sich entwickeln sollen – oder nicht. Wer erinnert sich nicht an Karies und Baktus, die den Kindern beibringen sollten, sich die Zähne zu putzen. Wie oft wird Pippi Langstrumpf als Heldin für junge Mädchen und Jungen aufgeführt? Helden sind wichtig für die Entwicklung. Aber gilt das nur für Kinder?
Schon der griechische Biograph Plutarch sah das ganz anders. Als er seine Lebensbilder großer Persönlichkeiten veröffentlichte, schrieb er zu seiner Motivation:
„Wir […] bereiten uns durch das Studium der Geschichte und das ständige Schreiben über sie darauf vor, das Andenken an die edelsten und bewährtesten Männer immer in unserer Seelen aufzunehmen und, wenn der unvermeidliche Verkehr mit unserer Umgebung etwas Schlechtes, Übelgeartetes oder Unedels an uns heranbringt, es abzustoßen und von uns zu weisen, indem wir unseren Sinn ruhig und unbeirrt auf die edelsten Vorbilder richten.“
Das Nachahmen der Helden ist also essentiell. Darum verkleiden sich die Besucher der ComicCon. Durch die Nachahmung ihrer Superhelden probieren sie, diesen nah zu sein. Dabei ist eines aber ganz klar: Keiner wird diese Helden wirklich erreichen können. Der Normalsterbliche wird an diese Superwesen nicht herankommen. Damit sind die Superhelden genauso unerreichbar wie die Helden der Antike.
Alleine diese kurze Einführung reicht aus, um die Ambivalenz, die im Heldenbegriff steckt anzudeuten. Auf der einen Seiten gibt es jene Helden, deren Beispiel man folgen soll, auf der anderen Seite ist diese Imitation unmöglich, weil der Held unerreichbar ist.
Vielleicht lässt sich die Heldenfigur besser packen, wenn man probiert, nicht sie selber, sondern ihre Aufgabe zu bestimmen. Damit meine ich nicht den Kampf gegen den Schurken oder die Rettung der Welt, sondern es geht um die kulturelle Funktion des Helden. Plutarchs Ansatz der Nachahmung führt nicht weiter, denn dadurch kommt nur ein Aspekt hervor. Und doch ist in Plutarchs Aussage ein wichtiger Hinweis, der auch von Hegel und anderen aufgegriffen wurde: Der Held braucht ein Publikum. Seine Abenteuer, seine Heldentaten zählen nichts, wenn niemand von ihnen erzählt und niemand sie hört, um dann eventuell daraus zu lernen.
Die Frage nach dem Publikum ist demnach wesentlich entscheidender als die Frage nach dem Helden. Für wen vollbringt der Held seine Heldentaten? Aber auch diese Frage ist komplex, denn auf diese Frage einzig mit einem „für uns“ zu antworten, reicht nicht aus, schon gar nicht in einer Welt, in der Gesellschaften miteinander verknüpft sind und dennoch probieren, sich voneinander zu unterscheiden. So verwundert es sicher wenig, wenn das Phänomen des Postheroismus vor allem für die westlichen Gesellschaften postuliert wird, während in anderen Teilen der Welt Helden weiterhin gebraucht werden.
Helden und ihre Geschichten finden wir in allen Kulturen der Welt. Es ist egal, ob man sich Märchen aus Südamerika, Mythen aus Afrika oder Legenden aus Asien ansieht. Überall gibt es diese Geschichten, in denen Menschen, Götter, Halbgötter oder ganz andere Figuren zum Wohle des Volkes, in dem die Geschichte erzählt wird, Taten vollbringen, die übermenschlich wirken. Das Publikum hört diesen Erzählungen zu und lernt daraus etwas. Nicht immer geht es dabei um die Imitation, manchmal geht es auch nur darum, dass einer von uns etwas geleistet hat. Denn alleine diese Gefühl des Dazugehörens ist für Menschen wichtig. Ich selber muss gar nichts machen, aber meine Familie, meine Sippe, mein Volk hat da einen oder eine in ihrer Mitte, die oder der Übermenschliches leisten kann, also könnte ich es auch.
Konjunktiv! Der ist hier wichtig, denn daraus zeigt sich eine weitere Funktion des Helden. Wenn Superman die Welt rettet, muss ich es nicht tun. Die ganze Verantwortung, die auf meinen Schulter lastet, kann ich den starken Armen des Helden übergeben. Er wird es schon richten und ich kann mich um mich selber kümmern.
Damit sind drei Funktionen des Helden schon einmal bestimmt: Er soll sein Publikum zum Nachahmen anregen, er soll Zusammenhalt garantieren und all die Arbeiten übernehmen, die ich nicht machen kann oder will. Das sind eigentlich drei gute Gründe, Helden zu brauchen. Warum also gibt es die Meinung, wir würden im postheroischen Zeitalter leben? Und wer vertritt solche Meinungen überhaupt?
Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama schrieb zu Beginn der 1990er Jahre davon, dass die Geschichte nun beendet sei. Mit dem Sieg der westlichen Welt über den Ostblock gäbe es nichts mehr, was man als historisch bewerten könne. Mittlerweile hat Fukuyama dieses Urteil revidiert und dennoch steckt in dieser Aussage für den Postheroismus ein Fünkchen Wahrheit. Denn am Ende der Geschichte schlägt man das Buch zu und der Held ist verschwunden. Danach beginnt in der Tat die post-heroische Phase, die Zeit nach dem Helden.
Der Kalte Krieg war vorbei, der letzte große Krieg des 20. Jahrhunderts war entschieden. Helden wurden überflüssig. Es war in diesem Jahrzehnt, als man zwar die Comichelden ins Kino brachte, sie aber nicht wirklich ernst nahm. Schon vorher hatte man die Superhelden vermenschlicht und versucht ihnen psychologische Tiefe und manchmal auch Abgründe zu verpassen.
Die Helden verschwanden und wurden von ihren Sockeln geholt. Die Militärs waren diejenigen, die sich dem Phänomen vor 30 Jahren zuerst annahmen. Sie erkannten, dass es nun im Einsatz keine Helden mehr bräuchte. Immer weniger junge Menschen waren bereit, ihr eigenes Leben für eine Sache zu opfern, die größer war, als sie selbst. Warum sollte man für das eigene Vaterland sterben, wenn man aus einer Kultur kommt, in der es nichts größere gibt als die Individualität des Einzelnen.
Das ist nun vor allem ein Phänomen des Westens. Dort wird die Individualität schon deswegen hoch geschätzt, weil die Zahl der Kinder zurückgeht. Der Kabarettist Georg Schramm brachte es einmal in seiner Figur des Oberst Sanftlebens auf den Punkt als er sagte: „Ab dem dritten Sohn gibt es Krieg!“
In der Tat wird von Politikwissenschaftlern und Soziologen davon ausgegangen, dass die Opferbereitschaft, für andere oder eine abstrakte Sache etwas zu riskieren, in einer Gesellschaft nicht mehr so weit verbreitet ist, je älter sie wird und je weniger Kinder es gibt. In Deutschland kommt zu dem noch ein weiterer Aspekt dazu. Bedingt durch den Missbrauch des Heldenbegriffs im Dritten Reich hat der Held einen schlechten Ruf. Das Sterben für etwas, was sich im Nachhinein als schlecht herausstellt, mindert den Wert des Opfers und damit den Wert des Helden gewaltig. Er selber wird absurd, seine Taten lächerlich. In Bezug auf den Krieg vor allem dann, wenn man an die Atomwaffen denkt, die jede Art von Heldentum unsinnig erscheinen lassen.
Helden werden aber gebraucht, das ist eine anthropologische Konstante. Vielleicht mag die Zahl derjenigen, die Helden sein wollen, sinken, doch es ändert nichts daran, dass der Mensch Helden benötigt – wenn auch nicht um sie nachzuahmen und selbst einer zu werden, dann wenigstens als Projektionsfläche für die Möglichkeit, die es geben könnte, wenn man machen würde, was man wöllte, hätte man die Zeit und Ressourcen.
Voller Bewunderung schaut man so auf diejenigen, die genau das tun, was man selber machen wollen würde, aber nicht kann. Das gilt für das Kino, in dem die Superheldenfilme Millionen einbringen und zwar weltweit, weil ihn ihnen der Held gegen einen Schurken kämpft, der alles sein kann, was der Zuschauer sich wünscht. Das gilt aber auch für die Welt außerhalb des Kinos, wo man sich über all diejenigen freut, die noch zur Freiwilligen Feuerwehr gehen, die noch mit den Armen und Zurückgelassenen der Gesellschaft interagieren und Jobs machen, für die man dann Applaus spendet. Doch wenn es darum geht, genau diesen Helden nicht nur Respekt zu zollen, sondern einen eigenen Beitrag, gar finanzieller Natur zu leisten, um diesen Alltagshelden zu helfen, dann ist man sauer auf ausfallende Busse, Züge und Kindertagesstätten. Der Held ist nicht mehr derjenige, den man imitiert, er ist nun derjenige, den man die Arbeiten aufbürdet, die man selber nicht machen will.
Und nach dieser Einleitung wollen wir schauen, ob die Nachahmung des Helden eigentlich immer das bestimmende Motiv war, oder ob nicht dieses Abladen der Aufgaben auch schon in bestimmten Heldenfiguren verankerte ist.
Schauen wir daher doch mal auf ein paar Klassiker und beginnen mit Herkules. Dieser ist sicherlich der bekannteste griechische Held, was daran liegen mag, dass er unzählige Heldentaten verbrachte. Seine Herkunftsgeschichte wurde zu einem Klassiker der Heldenliteratur. Während der Ehemann seiner Mutter Alkmene kämpft, verliebt sich Zeus in die Frau, verwandelt sich in ihren Ehemann und schläft mit Alkmene. Dann verlässt er sie, ihr wahrer Ehemann kommt heim ist verwundert, dass seine Frau ihm erzählt, doch letzte Nach kein Auge zugemacht zu haben vor lauter ehelicher Pflichterfüllung und erfährt durch einen Sehe die Wahrheit. Neun Monate später wird Herkules geboren.
In dieser Geschichte ist aber Amphytrion, Alkmens Ehemann, nicht der einzige gehörnte, denn auch die Frau des Zeus, die Göttin Hera, füllt sich verständlicherweise betrogen. Statt ihren Hass aber auf ihren Mann zu lenken, beschließt sie das Produkt des Betrugs zu hassen. Als Zeus stolz über die bevorstehende Geburt seines Sohnes, verspricht, in dieser Nacht würde der König von Tiryns geboren, sorgt Hera dafür, dass eben dort ein anderer Sohn, Eurystheus, geboren wird und zögert Kraft göttlicher Magie die Geburt des Herkules heraus. So wird, zum Ärger Zeus‘ nicht sein Sohn der König. Als unser Held dann doch geboren wird, sendet sie zwei Schlangen an dessen Wiege, doch der Held zeigt sich schon hier und mit jeweils einer Hand erlegt er beide Tiere. So lebt Herkules eigentlich ein gutes Leben, heiratet, zeugt unzählige Kinder, doch der Hass Heras kennt kein Ende und so kann sie ihn kurzzeitig mit Wahnsinn schlagen, in dem er alle seine Nachkommen tötet.
Und hier erst beginnt die Geschichte des heldenhaften Herkules. Die Ausgangsbedingungen sind ambivalent. Zwar ist der Vater ein Gott, was dem Helden enorme Stärke bringt, doch hat er auch ein schweres Schicksal, dass sich im Hass der Hera zeigt. Auf sich geladen hat er zudem den Tod seiner Kinder. Zum Glück haben antike Helden von der Psychoanalyse noch nichts gewusst und so geht es Herkules im Prinzip nur darum, die durch den Mord an seinen Kindern öffentliche Schuld abzutragen. Dafür muss er, so erklärt es ihm das Orakel von Delphi lediglich zehn Aufgaben erfüllen, die ihm ausgerechnet jener Eurystheus auferlegen soll, der an seiner statt über die Stadt Tiryns herrscht. Dieser weiß, dass er einzig Hera seine Stellung zu verdanken hat und fürchtet daher, als der Held vor seinem Thron erscheint, um seine Position. So schnell wie möglich, will er den Held nicht nur los werden, sondern tot sehen. Als dieser ihn um Aufgaben bittet, nimmt er sich zunächst vor, ihm solche zu geben, die dessen Leben auf jeden Fall beenden werden.
Herkules‘ Motivation ist eine öffentliche, keine tugendhafte. Es geht im nicht um Gerechtigkeit, außer für ihn selbst und auch nur vor den Augen der Öffentlichkeit. Er ist sich ja durchaus bewusst, dass er nicht nur ein Held, sondern auch der Sohn des Zeus ist. Also geht es schon bei diesem Helden nicht wirklich um die Nachahmung. Man soll an diesem Helden nicht Plutarchs edeles Vorbild finden, dafür ist dieser Held nicht nur übermenschlich, sondern auch zu sehr mit Schuld beladen. Wie also sieht es mit den anderen beiden Motiven aus? Taugt Herkules als Retter, der für mich Held ist, während ich mein Leben lebe? Oder als Projektionsfläche für das Griechentum, denn wir reden ja über griechische Sagen?
Gehen wir dafür die Heldensage des Herkules weiter durch. Insgesamt erfüllt Herkules nicht zehn, sondern ganze zwölf Aufgaben für Eurystheus, denn dieser erkennt zwei der erfüllten Aufgaben nicht an. Dazu gehört wohl die bekannteste Heldentat des Herkules, nämlich der Sieg über die Hydra, jenes mehrköpfige drachenartige Monster, dem Köpfe nachwachsen, wenn sie abgeschlagen werden. Als Herkules bei ihr auftaucht, hat sie nur sieben, als er ihr einen abschlägt, sind es schon neun. Darüber ist der Held so verärgert, dass er das einzig Richtige tut, nämlich alle Köpfe abzuschlagen, die er finden kann. Er gerät so sehr in Rage, dass nur sein ihn begleitender Freund Iolaos ihn wieder zur Vernunft bringen kann. Dann besinnt sich Herkules und bittet Iolaos jeden Hals, aus dem zwei Köpfe nachwachsen könnten, mit Feuer zu versenken – und das Wunder geschieht: Das Vieh stirbt. Doch die Hilfe des Iolaos ist es, was Eurystheus die Aufgabe nicht anerkennen lässt. Neben der Hydra besiegt Herkules noch einen starken Löwen, einen riesigen Eber und Menschen fressende Pferde. Er vertreibt zudem fiese Vögel und fängt einen Stier. All diese Wesen haben vor allem eines gemeinsam: Sie tyrannisieren Menschen und der Held befreit sie davon. So gesehen, sorgt Herkules dafür, dass man sich problemlos zurücklehnen kann, um den Helden seine Arbeit machen zu lassen.
Auch die zweite vom König nicht anerkannte Aufgabe ist so eine Aufgabe und bei ihr wird es sogar offensichtlich. Zugleich soll sie den Helden aber vor allem der Lächerlichkeit preisgeben, denn die Taten bis dahin haben ja dafür gesorgt, das Ansehen des Helden, der ja immer noch für den Mord an seinen Kindern sühnt, zu vergrößern. Im Laufe seiner Heldentaten wächst aber auch der Held weiter. Das positive Feedback, das er für seine geleistete Arbeit erhält, bringt ihn doch zum Nachdenken. Er hilft den Menschen, während er seine Sühnearbeit verrichtet. Also macht er diese ganzen Aufgaben gar nicht für sich selber, sondern für die anderen. Mit dieser Einstellung geht er an die nächste Aufgabe, bei der es darum geht, die Kuhställe des reichen Königs Augias auszumisten. Diese sind seit Jahren nicht gesäubert worden und der Gestank vertreibt die Bewohner seines Reiches.
Da Herkules sieht, worum es geht, macht er mit Augias einen Deal. Er bekommt zehn Prozent von dessen Herde, wenn es ihm gelingt, dessen riesigen Kuhstall in nur einem Tag zu säubern. Der König willigt ein und Herkules lenkt einfach den anliegenden Fluss durch die Ställe. Der Dreck ist weg. Durch diese kluge Lösung des Problems ist Herkules in den Augen der Griechen auf einmal nicht mehr nur stark, sondern auch noch schlau, was ihn zu einem noch viel besseren Helden macht. Augias will ihn übrigens nicht bezahlen, da Herkules ja im Auftrag des Eurystheus arbeitet. Doch vor Gericht bekommt der Held Recht. Der König von Tiryns aber erkennt die Aufgabe nicht an, weil der Held sich hat bezahlen lassen.
Man möchte sich bei dieser Heldentat auf Seiten des Königs sehen. Ein Held, der sich bezahlen lässt, für eine Aufgabe, die er übernommen hat, um für den Mord an seinen Kindern zu sühnen? Trotz aller Stärke und Schläue, zur Nachahmung taugt dieser Held nur dann, wenn man nur vom öffentlichen Narrativ weiß und nicht die Hintergründe kennt. Aber Öffentlichkeit ist nun mal alles und so besteht der Held alle Aufgaben, zeigt, wie schwach und feige der König ist, von dessen Regierungsarbeit man nichts erfährt, und heiratet ein zweites Mal. Bei der Heimreise wird seine neue Braut Deianeira entführt, doch Herkules kann den Entführer auf lange Distanz mit Pfeil und Bogen erlegen. Dieser flüstert der Frau im Sterben noch schnell zu, sie solle sich ein wenig von seinem Blut mitnehmen, denn irgendwann mag ihr Mann sie vielleicht nicht mehr lieben und dann kann ihn dieses Blut in ein Hemd geträufelt, töten. Als Deianeira nach einiger Zeit erfährt, dass Herkules eine junge Frau gerettet und vor hat, diese mit nach Hause zu bringen, setzt sie diesen Plan um. Der Held, voller Freude über das Geschenk seiner Frau, zieht das Hemd an und leidet die größten Schmerzen, während sich das Hemd durch seine Haut frisst. Im Kampf mit sich selber reist er sich die Haut und das Fleisch bis auf die Knochen vom Leib und springt nach Linderung suchend ins Wasser. Doch das macht es nur schlimmer. Das giftige Blut des getöteten Entführers erhitzt das Wasser und zwar so sehr, dass es auch, nachdem Herkules wieder aus dem Gewässer gesprungen ist, heiß bleibt und deswegen Thermophylen genannt wird. Herkules schafft es schließlich seine Freunde dazu zubringen, ihn zu töten. Sein Vater Zeus jedoch hat ein Einsehen und holt seinen Sprössling auf den Olymp. Dort bewacht er den Eingang und fällt vor allem dadurch auf, dass er viel frisst und säuft. Ihr Hassobejekt so zu sehen, sorgt sogar dafür, dass Hera Herkules vergibt und ihm eine dritte Ehe zuteil werden lässt – mit ihrer Tochter Hebe.
Was für ein Held! Nachahmungswürdig ist er kaum, aber erledigt zumindest die Arbeit, die man selber nicht machen will. Und er taugt sogar als Projektionsfläche, wenn man die negativen Aspekte ausblendet. Oder ist es ein Zufall, dass der Geschichtsschreiber Herodot eine der heroischsten Szenen seines Werkes genau an jenen Gewässern spielen lässt, in die Herkulesim Todeskampf sprang?
Die Rede ist vom vergeblichen Kampf des spartanisches Königs Leonidas, der mit einem Heer von 300 Kriegern vergeblich probierte, dass gewaltige Heer der Perser aufzuhalten, dabei aber zusammen mit diesem den Heldentod starb. Herodot beschreibt diese Episode der Perserkriege ausführlich in 30 Kapiteln seiner Historien. Und schon ganz am Anfang wird König Leonidas mit einem Beinamen beschrieben, der aufhorchen lässt: Er sei ein Heraklide gewesen. Damit sind in den Sagen des griechischen Alterums eigentlich die Kinder und Enkel des Herkules gemeint. Auch diesen kommt eine besondere Rolle zu, denn sie erobern schließlich den Thron ihres heldenhaften Urahnen. Und wie so oft mit Mythen und Legenden haben sie einen wahren Kern oder zumindest probiert der ein oder andere, einen solchen Kern herzustellen. So korreliert der Untergang des Eurystheus mit dem Untergang der mykenischen Kultur und der Einzug und Sieg der Herakliden mit der Dorischen Wanderung, einer nach und nach einsetzenden Migrationsbewegung einer Volksgruppe deren Herkunft nicht ganz klar bestimmbar ist. Sicher ist aber, dass das Altgriechische durch diese Volksgruppe erst entstand, denn das Mykenische gehört nicht zum Indoeuropäischen Sprachraum. Die Dorer waren sich dieser Korrelation mit der griechischen Sagewelt wohl bewusst und ernannten Herkules zu ihrem mystischen Stammvater. Die wohl politisch einflussreichste ganz klar dorisch geprägte Polis auf der Peloponnes aber war Sparta.
Der Held wird so zur Projektionsfläche für das Fremde, das sich der heimischen Mythologie bedient und mit dieser Hilfe Teil dessen wird, was vorher da war, während es große andere, ältere Werte verdrängt. Herodot führt dieses Fremde gekonnt zusammen. Im Angesicht der übermächtigen Gefahr durch die Perser schließen sich die griechischen Städte zusammen und kämpfen gemeinsam. Doch im Angesichts des Todes, eines aussichtslosen Kampfes gegen eine Übermacht, an deren Ende klar ist, dass nur der Tod stehen kann, da, so schreibt es Herodot, stehen alleine die Spartaner und kämpfen bis zum letzten Mann und selbst der Heraklide Leonidas fällt im Kampf.
Für Herodot wird aus diesem Tod ein Vorbild für die Griechen, die aufrecht und heldenhaft den guten Kampf kämpfen und bereit sind, dafür zu sterben. Das ist doch mal eine Projektion dessen, was man aus dieser griechischen Sage herausholen kann. Und dies gilt nicht nur für die Griechen.
Ein Land zerrissen in kleinen städtischen Strukturen, geeint in der Sprache und der Kultur, vereint gegen den gemeinsamen Feind? Das klang für die Deutschen des 18. und 19. Jahrhunderts durchaus vertraut. So gab es auch hier die ein oder andere Bestrebung sich das Griechentum als Vorbild für das Deutsche zu nehmen. Die Übersetzungen von Homer, Herodot und anderen griechischen Schiftstellern in unsere Sprache fand nicht umsonst in jenen Jahrhunderten statt.
Selbst heute hat die Schlacht an den Thermophylen nichts an Reiz verloren. Denn diese Geschichte inspirierte den Comiczeichner Frank Miller zu einem Werk mit dem Namen 300, das wiederum durch Zack Synder verfilmt wurde. Dieser Film wurde zum Kult – nicht nur im Mainstream, sondern auch bei den Neurechten, die in dem Opfertod für das Vaterland ihre Ansichten des Widerstands bestätigt sehen.
Die Sage um Herkules führt so auf Umwegen direkt zu uns in die Moderne. Der Held, der nur deswegen heldenhaft ist, weil er den Mord an seinen Kindern sühnen möchte, wird zum Helden, der durch seine Frau vergiftet, stirbt. Durch seine Heldenmut aber beeinflusst er die griechische Geschichte, unsere Popkultur und politische Bewegungen.
Wen er indes kaum begeisterte, war Ovid. Als dieser sich des griechischen Mythenstoffs bediente um seine Metamorphosen zu schreiben, wird Herkules zwar immer mal wieder erwähnt, doch nimmt Ovid stets die Position seiner Gegner ein, die voller Verbitterung davon erzählen, wie Herkules sie besiegte. Der griechische Held taugt nicht zum Römer, auch wenn ich ihn hier die ganze Zeit mit seinem lateinischen Namen und nicht etwa mit seinem griechischen, Herakles, bezeichnet habe. Die Römer hatten ihre eigenen Helden, die sie tief in ihrer eigenen Stadtgeschichte fanden. Einen dorisch-griechischen Helden brauchten sie nicht.
Und genauso wie die Römer Mühe mit dem griechischen Erbe hatten so hatten auch die Deutschen ihre liebe Mühe mit dem römischen Erbe. Das war wohl ein weiterer Grund, warum sie dem Griechischen den Vorzug gaben. Der Sieg des Arminius über die Römer im Jahre 9 n. Chr. war ein so entschiedenes Ereignis, dass die Deutschen hier ihren eigenen Held fanden. Als Quelle dazu aber nutzten sie ausschließlich lateinischen und griechische Autoren. Eine Beschreibung des Charakters dieses Helden bietet der einzige Augenzeuge der Schlacht, der Jahrzehnte später auch eine römische Geschichte schrieb. Dieser Valleius Paterculus sagt über den Mann, der im 19. Jahrhundert zum Urdeutschen gemacht wurde, Folgendes:
„Daraufhin erschien ein junger Mann von edler Geburt, mutig im Handeln und wachsam im Verstand, der eine Intelligenz besaß, die weit über den gewöhnlichen Barbaren hinausging; Er war nämlich Arminius, der Sohn von Sigimer, einem Fürsten dieses Volkes, und er zeigte in seinem Gesicht und in seinen Augen das Feuer des Geistes in sich. Er war ständig mit uns in privaten Kampagnen in Verbindung gebracht worden und hatte sogar die Würde eines Ritters erreicht. Dieser junge Mann nutzte die Nachlässigkeit des Generals als Gelegenheit zum Verrat und sah scharfsinnig, dass niemand schneller überwältigt werden konnte als der Mann, der nichts fürchtete, und dass der häufigste Beginn einer Katastrophe ein Gefühl der Sicherheit war.“
Eigentlich eine recht positive Beschreibung für einen Feind, doch dann gegen Ende hin, folgt ein kleines Wörtchen, das wenig Heldenhaftes in sich birgt: Verrat. Was meint er damit?
Um das zu klären, müssen wir uns zuerst dem griechischen Autoren Cassius Dio widmen, der im Detail über die Schlacht geschrieben hat. Er weiß zu berichten, dass die Germanen mit der römischen Oberherrschaft und vor allem mit der Person des Varus sehr unglücklich waren, denn während sie sich zunächst mit den Römern arrangierten konnten, war es Varus, der ihnen auf einmal Befehle erteilte und Tributzahlungen einforderte. Daraufhin verfielen die Germanen auf eine List: Sie behandelten Varus übertrieben freundlich und währten ihn in Sicherheit, so dass er dazu überging, weniger Truppen in unmittelbarer Nähe zu stationieren. Diese Idee ging auf Arminius zurück, der sich selber gerne als Gast und Freund des Varus bezeichnete. Und dann passierte, wovor viele wirkliche Freunde und Verbündete Varus gewarnt hatten. Arminius und die seinen
„begleiteten [Varus] auf dem Marsch, und als sie dann entlassen worden waren, um die Hilfstruppen zu mobilisieren und schleunigst zur Unterstützung heranzuführen, übernahmen sie die schon irgendwo in Bereitschaft stehenden Streitkräfte, ließen jeweils die in ihrem Heimatgebiet stationierten römischen Soldaten, die sie früher von Varus angefordert hatten, niedermachen und griffen dann Varus selbst an, der sich mittlerweile schon in schwer passierbaren Waldgegenden befand. Dort erschienen die vermeintlichen Untertanen plötzlich als Feinde und richteten furchtbares Unheil an.“
Falsches Spiel und Verrat als Tugenden des urdeutschen Helden? Das klingt nicht sehr nachahmenswert, aber es taugt doch als Projektionsfläche, zumindest, wenn man an den Quellen ein wenig herum schraubt. Denn kann man römischen Schriftstellern trauen? Haben die Verlierer hier nicht probiert, ihre Niederlage zu erklären, ja eine Ausrede dafür zu finden? Zeugt die Tat des Arminius nicht viel mehr von Freiheitsliebe, Tatendrang, Strategie und Intelligenz? Das sind nun Tugenden, die man klar einem Helden zuschreibt. So wurde dann der Arminius im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter des Nationalismus, zu einer Figur des Deutschtums schlechthin, was nicht nur im Hermannsdenkmal bei Detmold gipfelte, sondern auch in einem Denkmal, das deutsche Auswanderer in New Ulm in den USA Ende des 19. Jahrhunderts errichten ließen.
Ausschlaggebend war Heinrich von Kleist, der eben nicht nur ein verspäteter Romantiker, sondern auch ein glühender Nationalist der deutschen Sache war. Er verfasste zwischen 1808 und 1809 sein Drama über die Hermannsschlacht, das natürlich von den Zeitgenossen nicht als Kampf der Germanen gegen die Römer, sondern als Kampf der Deutschen gegen die Truppen des Franzosenkaisers Napoleon angesehen wurde.
Kleist beschreibt seinen Hermann in einem ganz anderen Licht und lässt ihn das Folgende sagen:
„Ihr Freund, ich bitt euch, kümmert euch um meine Wohlfahrt nicht! Bei Wodan, meinem hohen Herrn! So weit im Kreise mir der Welt das Heer der munteren Gedanken reichet, erstreb ich und bezweck ich nichts, als jenem Römerkaiser zu erliegen. Das aber möcht ich gern mit Ruhm, ihr Brüder, wies einem deutschen Fürsten ziemt: Und daß ich das vermög, im ganzen vollen Maße, wie sichs die freie Seele glorreich denkt – will ich allein stehn, und mit euch mich – – Die manch ein andrer Wunsch zur Seite lockend zieht, – in dieser wichtgen Sache nicht verbinden.“
Nicht für den Sieg will der deutsche Held kämpfen, sondern für den Ruhm. Das Sterben für die Freiheit liegt ihm am Herzen bei gleichzeitiger Angst um seine Gefährten. So möchte er am liebsten alleine aufbrechen. Aber kommt uns dieses Heldenmotiv nicht bekannt vor? Ist es nicht ein ähnliche Geschichte wie die des Leonidas? Für die Freiheit sterben? Heldentaten um des Ruhmes willen? War das nicht des Herkules‘ Antrieb? Der verschlagene Arminius wird immer mehr zum Helden.
Es war daher kein Wunder, dass man immer wieder probiert hat, diesen Arminius mit einem anderen deutschen Helden gleichzusetzen, allerdings mit einem Literarischen. So wurde die Armee des Varus, die sich in langer Kolonne durch den Teutoburger Wald bewegte schnell zum Lindwurm, der durch Siegfried erlegt wurde, den Helden des Nibelungenliedes. Arminius und Siegfried zu ein und der selben Heldenfigur zu machen, bot sich an, denn zwei Helden für ein Volk, hätte stets zu Uneinigkeit darüber geführt, wer von beiden der bessere Held sei und außerdem war ja der Charakter des Arminius in den Quellen als durchaus ambivalent geschildert worden. Aber Siegfried? Der galt als untadelig, als Idealbild des mittelalterlichen Helden. Oder etwa nicht?
Über Siegfried berichtet das Nibelungenlied. Darin taucht er schon in der zweiten Aventüre auf. Über seine Herkunft und ihn selber erfährt der interessierte Leser eine ganze Menge. So stammt er aus Xanten, ist königlicher Abstammung, stark und wunderschön, was die Damen durchaus bezaubert. Er ist großzügig und ohne Furcht, aber lebt in Ehrfurcht vor Gott. Er verrichtete zudem auch Minnedienst für verschiedene Damen, doch ließ er sich nie mit ihnen ein, bis er hörte, dass in Worms die schönste aller Frauen leben sollte. Diese aber war den Bewerbern gegenüber äußerst widerspenstig und so will Siegfried sein Glück bei Kriemhild versuchen, wobei es dem Helden recht egal ist, ob er es im Guten hinbekommt, oder er „mit ellen da min hant“, also durch die Kraft seines Arms, das Land und seine Bewohner erobert. Sein Vater indes ist klug genug, unseren Helden von dieser Einstellung abzubringen. Ein Held, der um der Liebe willen, ein Land erobern möchte? Besonders clever scheint dieser Siegfried nicht zu sein. Im Gegensatz zu Arminius, der seinen Verstand einsetzt, um die Übermacht der Römer zu besiegen.
Der Kampf mit dem Drachen wird im Nibelungenlied gar nicht genau beschrieben, sondern findet lediglich durch eine Nacherzählung aus dem Mund Hagens von Tronje Erwähnung. Wichtig ist dabei vor allem der Schatz, den unser Held beim Kampf erworben habe. Gunnar, König von Worms, dem diese Geschichte erzählt wird, geht daraufhin zu Siegfried, um ihn zu begrüßen. Doch unser Held hat nicht Besseres zu tun, als den König von Worms zum Kampf zu fordern, was aber zum Glück durch den Bruder des Königs, Gernot, verhindert wird, der Siegfried als Gast willkommen heißen möchte. Dieser Siegfried scheint doch irgendwie der Prototyp jener Form von Held zu sein, der zwar nett aussieht und auch stark ist, dessen Verstand aber doch ein wenig unterentwickelt ist. Dennoch scheint Siegfried immerhin edelmütig zu sein, oder?
In der Geschichte ist es nicht nur so, dass Siegfried gerne die Kriemhild möchte, auch König Gunnar ist verliebt. Er möchte sich gerne mit Brunhild vermählen, einer mutigen, kampferprobten Frau, die nur denjenigen heiraten will, der es schafft, sie zu besiegen. Gunnar ist dazu nicht in der Lage, Siegfried schon. Also verfallen beide auf einen Trick. Siegfried hat vom Kampf mit dem Drachen eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar macht. So kämpft er zusammen mit Gunnar gegen Brunhilde, gewinnt und jene fügt sich ihrem Wort, folgt dem schwächlichen Gunnar nach Worms und wird seine Frau. Und erneut: Der Held zeigt seine Schattenseiten. Der Edelmut ist dahin, die Wahrheit bleibt auf der Strecke, mit einem Trick hilft er, eine Frau zu überlisten. Ein wahres Heldentum mit weißer Weste scheint es nicht zu geben.
Und die Geschichte um diesen eher schlichten, gewalttätigen Helden, der sich für eine betrügerische Scharade hergibt, mutierte zum Nationalepos der Deutschen. Friedrich de la Motte-Fouque, Friedrich Hebbel und vor allem Richard Wagner machten aus dem Stoff eine Geschichte des Deutschen überhaupt, beseelt davon, das Wesen des Deutschen heraus gefunden zu haben. Der Begriff Nibelungentreue kam auf, denn die Treue ist es, was den Deutschen auszeichnet. Damit ist es gar nicht dieser Siegfried, der da als treu erscheint. Der wahre Held dieser Geschichte oder besser die wahre Heldin ist Kriemhild, die Witwe Siegfrieds, nachdem dieser durch Hagen von Tronje ermordet wurde. Auch sie ist nicht frei von Schuld, denn ohne ihre Informationen zur verwundbaren Stelle ihres Gatten, hätte Hagen niemals herausgefunden, wie der unverwundbare Siegfried zu töten sei. Doch sie steht treu zu ihrem Mann und rächt ihn, in dem sie auf die brutalste Weise ihre Familie, die mit den Tod ihres Mannes allesamt in Verbindung stehen, umbringen lässt. Der gesamte zweite Teil des Nibelungenliedes ist dieser starken, von Rachsucht getriebenen, aber doch treuen Frau gewidmet. Wenn die Treue schon eine deutsche Tugend ist, dann in dieser Ehefrau.
Helden zeichnen sich durch Tatkraft aus. Sie kämpfen, arbeiten, jagen und töten, alles Tätigkeiten, die vor allem von Männern ausgeführt werden. So verwundert es wenig, dass es meistens diese Männer sind, die auch zu Helden werden. Hinzu kommt ein weiter Aspekt. Da aus diesen Helden Stammväter werden, wie Herkules für die Doren und Siegfried oder Hermann für die Deutschen, ist es wichtig, dass es Männer sind. Denn erbberechtigt waren nur die Männer, eine Stammfolge konnte man nur über Männer herleiten. Der Held ist also ein Mann. Es sei denn man schaut einmal in jene Regionen der Welt, in der Stammfolge auch über die Mutter geregelt werden kann, wie in Westafrika.
Beim Volk der Mossi aus Burkina Faso gibt es zwar auch einen männlichen Gründer, doch dessen Mutter hat die weit aus spannendere Geschichte. Ihr Name ist Yennega, Tochter des Königs von Gambaga. Dieser hatte keinen Sohn, der ihm bei der Verteidigung seines Reiches und der Eroberung neuer Einflussbereich hätte unterstützen können und so erzog er Yennega als Kriegerin. Sie lernte die Armee befehligen, ging auf die Jagd und führte den Befehl in so mancher Schlacht. Sie war dabei sehr erfolgreich, machte zahlreiche Beute und erfüllte ihren Vater mit großem Stolz, so großem Stolz, dass er vergaß, dass er eine Tochter hatte, für die es eigentlich ja eine andere Bestimmung gab. Für Töchter war die Heirat und des Kinderkriegen vorgesehen. Dafür mussten ihre Väter irgendwann Sorge tragen, indem sie Brautschauen arrangierten und Kontakte knüpfen. Aber Yennegas Vater vergaß es schlicht. Yennega aber wollte nicht auf Dauer ein Mann sein, sie wollte irgendwann heiraten und Mutter werden, darum flehte sie ihren Vater an, doch endlich alles Nötige in die Wege zu leiten. Ihr Vater aber, wollte nicht so recht und so floh Yennega von ihrem Vater, dem Hof und der Stadt Gambaga. Auf ihrem Pferd ritt sie davon, bis dieses erschöpft auf einer Lichtung stehen blieb. Dort stand eine junger Mann, stark und gut aussehend, ein Elefantenjäger mit Namen Rialé. Auch er war ein Geflüchteter aus hohem Haus, Sohn des Königs der Malinke, doch war er von seinen Brüdern um den Thron gebracht worden. Es kommt, wie es kommen musste. Yennega und Rialé vermählten sich und blieben zusammen. Aus ihrer Verbindung ging ihr Sohn Ouedraogo hervor. Als dieser zehn Jahre alt war, schickten seine Eltern ihn zu seinem Großvater, dem König von Gambaga, der über den Verlust seiner Tochter zutiefst traurig war. Als er seinen Enkel erblickte, wurde er fröhlich und wünschte seine Tochter wiederzusehen. Diese besuchten ihren Vater zwar, doch bleiben wollte sie nicht. Sie ließ nur ihren Sohn da, damit er in die Lehre gehen konnte. Yennenga starb an der Seite ihres Mannes und wird bis heute von den Mossi hoch verehrt.
Endlich eine wahre Heldin! Sie ist gut im Kampf, edelmütig, folgt ihren Idealen und bleibt bis zu ihrem Tod dabei. Eine wahre Stammmutter für ein Volk. Kein Fehl, kein Tadel, nur Kraft und Edelmut. Yennenga ist so eine Heldin, die als Projektionsfläche dienen kann, eben für die Mossi, die sich auf ihre Taten berufen und ihren Charakter als den Charakter ihres Volkes ausgeben können. Gleichzeitig ist sie eine Figur, die man nachahmen kann. Nur eines ist sie nicht: Eine Heldin, die einem die Arbeit abnimmt. Ganz im Gegenteil fordert sie dazu auf, zu machen und eben nicht zu warten, bis jemand anderes etwas tut.
Der Clou an ihr ist dabei, dass sie nicht darum kämpft, etwas Außergewöhnliches zu wollen, sondern etwas Gewöhnliches. Sie will das sein, was eine Frau in Ihren Augen und in denen Ihres Volkes zu sein hat: Ehefrau und Mutter. Ganz anders zeigt sich da die französische Nationalheldin Johanna von Orleans. Damit sie zur Heldin werden konnte, musste sie ihre Weiblichkeit ablegen und Mann werden, sich eine Rüstung anziehen, kämpfen und für ihre Ideale auf dem Scheiterhaufen der Engländer sterben, die in ihre eine absolut berechtigte Gefahr sahen. Sie hätte die Franzosen des 15. Jahrhunderts, die erschöpft von den Kämpfen des 100jährigen Krieges kriegsmüde geworden waren, wieder mobilisieren können. Johanna reitet, beseelt von einer göttlichen Mission, erst zum geheimen Aufenthaltsort des Königs, der sich als Diener verkleidet und dennoch von ihr erkannt wird, dann mit mehreren Truppen in die Schlacht, um Orleans mit Nahrung zu versorgen. So schafften es die Franzosen unter Johanna die Engländer nach und nach aus dem Süden zu vertreiben. Teil des Heldenmythos um Johanna ist aber auch, dass ihre Bemühungen den König zum Sturm auf Paris zu bewegen, um die Engländer endgültig los zu werden, an dessen Berater scheiterten. Diese trauten einer Frau trotz all ihrer Erfolge nicht zu, so etwas zu leisten. Als sie nach langem Bitten, dann doch dazu kam, ihren Plan umzusetzen, scheiterte dieser, was die widerspenstigen männlichen Berater wiederum bestätigte. Zudem ließ der König sie fallen und überließ sie ihrem Schicksal. Durch Verrat gelangte sie in die Hand der Engländer, die ihr gleich zwei Inquisitionsprozesse bereiteten, an deren Ende ihre Verbrennung stand. Vorgeworfen wurde ihr Häresie und Mord, als Frau war sie ja keine Soldatin und alle von ihr in Schlachten umgebrachten Krieger waren daher Opfer einer Mörderin. Aus Angst vor dem Tod gestand sie zunächst alles ein und wurde zunächst nur zu lebenslanger Haft verurteilt. Und wenn die Engländer es dabei belassen hätten, würden wir über diese Frau wohl auch kaum als Heldin sprechen. Doch die Politik wollte ihren Kopf. In dem zweiten Prozess kam es dann auch endlich zur Verbrennung der Frau, die die Franzosen zur Nationalheiligen erklärten, und zwar alle, ganz unabhängig ob sie Monarchisten waren oder Liberale. Für die ersten setzte sie den König wieder auf den Thron, für die letzten kämpfte sie für die Freiheit Frankreichs. Dabei taugt auch Johanna nicht als tadellose Heldin. Sie versagt bei der entscheidenden Schlacht und steht im Angesicht des Todes nicht zu ihrem Ideal. Welch Vorlage für stolze Franzosen, doch auch ihr kann man immerhin die Arbeit aufladen, die man selbst nicht machen möchte. So erklärt sich auch ihre Position als Nationalheillige. Das Wort solcher Heiligen wiegt in Gottes Ohr schwerer als das des Normalsterblichen.
Es hat fast den Anschein, um einen wirklichen Helden zu finden, dem es nachzueifern gilt, muss man nach Westafrika gehen und eine Frau finden, die für ihre Werte einsteht. Was für eine sonderbare Heldenfigur ist diese Yennega, die dafür kämpft das Normale, das Alltägliche zu haben. Auf der anderen Seite ist es das, was einen Helden auszeichnet, findet zumindest der russische Schriftsteller Fjodor M. Dostojewski, dem zugeschrieben, das Folgende gesagt zu haben:
„Held sein, eine Minute, eine Stunde lang, das ist leichter als in stillem Heroismus den Alltag tragen. Wer diesen grauen Alltag erträgt und dennoch dabei Mensch bleibt, der ist wahrhaft ein Held.“
Dostojewskis Bonmont ist bemerkenswert. Ganz losgelöst von der Idee eines Übermenschen konzentriert er sich auf das alltägliche Leben, nicht auf das Außergewöhnliche. Der Held, der für uns Arbeiten übermittelt, spielt für ihn keine Rolle. Die Werte, die im Ertragen des Alltags liegen, sind für ihn, das, was den Menschen auszeichnet. So wird jeder zum Helden und jeder kann in dieses Bild sein eigenes Leben hinein projizieren. Das Erdulden des Alltags ist heroischer Akt und wichtiger als das Kämpfen von Schlachten. So ist dann wohl auch die Auszeichnung zu verstehen, die man in den Ländern des real existierenden Sozialismus an besonders ausdauernde Arbeiter vergab: Der Held der Arbeit, ein Vorbild für die anderen, so zu sein, wie dieser Held. Allein: Man muss die Arbeit selber machen!
Der kleine Ausflug in die Kulturgeschichte des Helden hat eines bisher gezeigt, es gibt zwei Arten von Helden. Jene Vielzahl, bei denen man Schattenseiten findet, obwohl sie als Vorbilder gelten, vor allem, weil sie uns als übermenschliche Entitäten Arbeit abnehmen, und jene eine, die als Vorbild wirklich dienen kann, weil sie für sich selber kämpft und zeigt, wie man zu seinen Werten steht.
Und welche Heldenrolle ist nun tot? Es ist diese letzte, die es kaum gegeben hat. Sie ist verstorben, weil es zu wenig von ihr gab. Geblieben sind die anderen, diejenigen, die uns die Arbeit abnehmen sollen, damit wir es nicht selber tun müssen. Die Superhelden des Kinofilms, die vereint gegen das kosmische Böse kämpfen, aber eben alle ihre Macken und dunklen Stellen haben. Eindringlich wird das an dem Superhelden schlechthin: Superman.
Diese Figur war von ihren Schöpfern ursprünglich nach Nietzsches Übermenschen konzipiert worden. Ein Mensch, der wegen seiner Kräfte außerhalb des Menschlichen steht, und daher auch nicht innerhalb von menschlichen Moralstandards agiert. Doch diese Idee von Jerry Siegel und Joseph Shuster floppte kolossal. Erst als sie ihn ein paar gute amerikanische Werte verpassten, wurde der Mann aus Stahl zu einer der beliebtesten Figuren der Comicwelt.
Dennoch bleibt ja die ursprüngliche Überlegung bestehen. Warum sollte jemand, der Superkräfte hat, moralisch sein? Dass mit großer Kraft, auch große Verantwortung kommt, hat zwar Peter Parkers Onkel Ben schon gewußt, ohne das er ahnte, dass sein Neffe, Spider-Man war, doch warum ist das eigentlich so. Wer singulär ist, für den gilt der kategorische Imperativ eines Kant nicht mehr, denn ein Gesetz, das ihn schützt, eine solche gesellschaftliche Ordnung, die vom eigenen Willen abstrahiert werden könnte, braucht der Superheld, egal ob mit Keule und Löwenfell wie Herkules, oder mit rotem Cape wie Superman, nicht mehr. Ist ihm die Menschheit dann nicht egal?
Die Antwort auf diese Frage gibt nicht nur Hegel, sondern auch der französische Schriftsteller André Malraux, der darauf hinwies, dass es ohne Publikum keine Helden geben könne. Eine aktuelle Version dieser Idee bietet die Serie The Boys. Ein Unternehmen hält sich Superhelden, von denen die sieben Beten in einem außergewöhnlichem Kreis zusammensitzen. Nach außen wirken sie wie der nette Superheld von nebenan, doch nach innen, tun sie, was sie wollen. Die Tugenden und Werte, die sie repräsentieren, sind ihnen egal. Der schlimmste von ihnen, ihr Anführer, Homelander, der nicht nur ein rotes, sondern ein rot-weiß-blaues Cape trägt, ist süchtig, danach, von seinem Publikum geliebt zu werden, obwohl er die Macht hätte, alle Menschen auszurotten. Aber er tut es nicht, denn er braucht das Publikum.
Dieses Publikum indes will gar nicht so sein, wie die Helden, auch wenn sie fleißig jedes Produkt kaufen, das das Konterfei ihrer Helden trägt. Es will nur, dass die Helden sie beschützen, damit sie selber nicht aktiv werden müssen. Die Titel gebenden Boys sind dabei die Ausnahme, sie sind selber tätig und probieren diese Superhelden, deren Spiel sie durchschauen, zu vernichten. So wird, derjenige, der sich seiner Sache selber annimmt, zum Terroristen, zum Outlaw einer Gesellschaft, die von den anderen mehr erwartet als von sich selbst.
Und so fragen dann die Feuilletons der Bundesrepublik, ob der Heroismus zurück sei, wenn Menschen Greta Thunberg und Carola Rackete zujubeln. Und dort, wo man eher dem rechten Spektrum angehört, glaubt man bis heute, dass Donald Trump, der wie Tony Stark, der Ironman aus den Marvelfilmen, oder wie Bruce Wayne, der geheimen Indentität von Batman, Milliardär ist, sie retten kann. So hofften die paar Demonstranten, die im August den Reichstagseingang blockierten, eigentlich nur darauf, von Donald Trump bemerkt zu werden, den sie in Berlin wähnten.
Rackete löst für uns im Alleingang das Flüchtlingsproblem, dessen Realität nicht nur bedeutet, Menschenleben zu retten, sondern auch auf Dauer zu erhalten, und Greta Thunberg inspiriert zwar die Bewegung der Fridays for Future, aber während viele von Ihnen mit den SUVs ihrer Eltern zu den Demonstrationen gebracht werden und auf ihren iPhones die Bilder teilen, die sie nicht nur bei Demonstrationen, sondern auch an den exotischen Orten der Welt zeigen, ist ihre Antwort eigentlich nur, dass jemand anders die Regelungen treffen soll, die eine Wissenschaft, die qua Definition nicht eins sein kann, weil es sonst das Ende des wissenschaftlichen Fortschritts wäre, vorformuliert hat.
Aber, wie ein Aufsatz des Ideologie- und Filmkritikers Wolfgang M. Schmitt heißt: „Es rettet uns kein Superwesen!“ Wir selber sind diejenigen, die etwas tun müssen. Die Hoffnung auf den einen, der alles richten wird, so Schmitt, sie antidemokratisch und autoritär, denn dieser eine komme ohne eine Legitimation aus, weil er von sich aus das Gute tue und es auch durch Superkraft tun könne. Der Held muss aufgrund seiner Stärke nicht gut sein, er kann, wenn er will. So bleibt stets der Zweifel. Bei Herkules, bei Siegfried, bei Arminius und auch bei Johanna. So besinnen wir uns doch auf Yannenga und Dostojewski und werden selber Helden des Normalen und des Alltags.