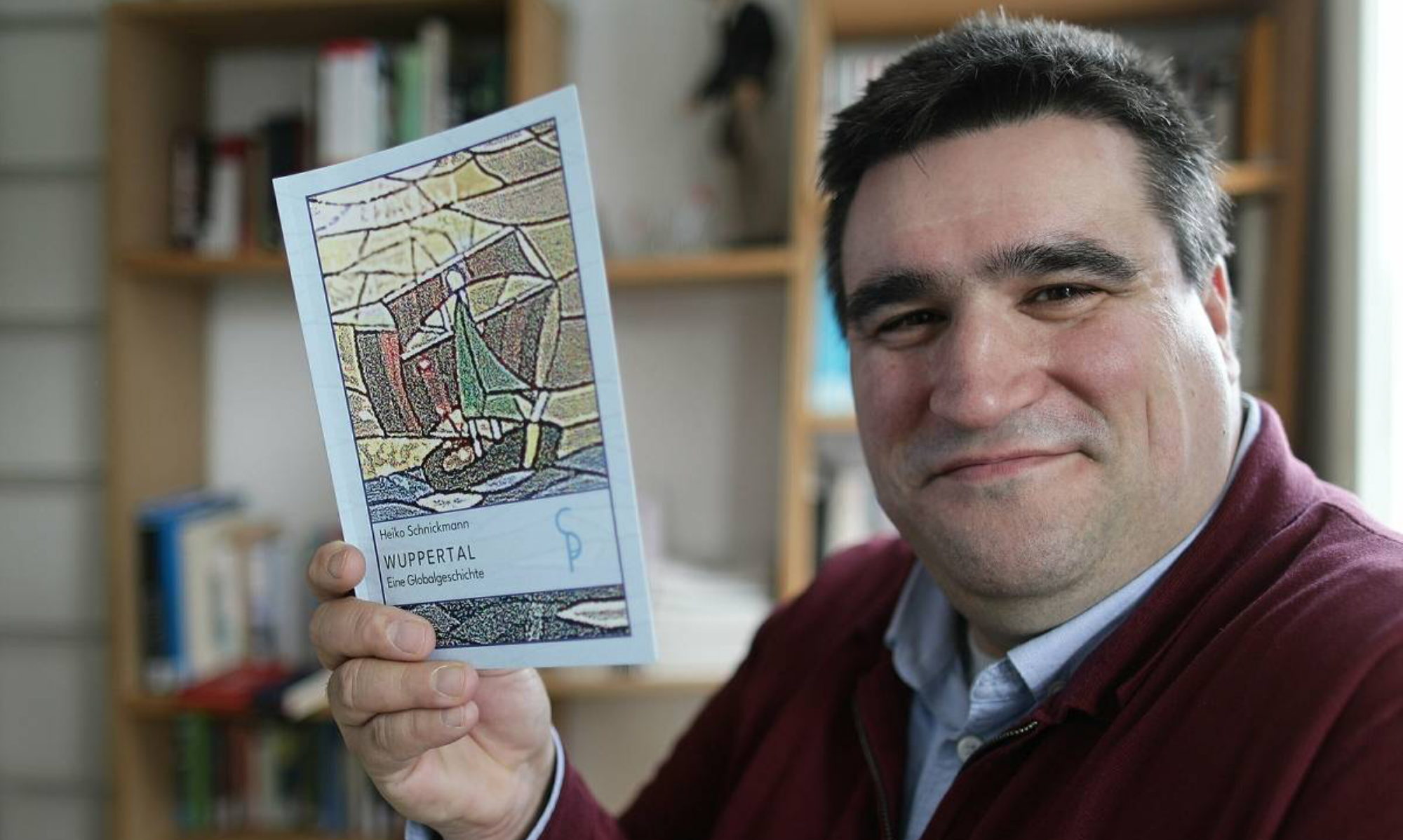Als Historiker begibt man sich damit auf ein gefährliches Terrain, denn diese Postmoderne ist ein sehr seltsames Gebilde. Sie kennen diese wohl, sonst wären Sie kaum hier, doch so richtig fassbar ist dieses Ding nicht. Es fällt sogar schwer zu sagen, ob es sich um eine Epoche, eine Bewegung, eine Geisteshaltung oder was auch immer handelt.
Das fängt schon damit an, dass niemand so genau weiß, wann dieses Zeitalter, wie ich es in der Vorankündigung genannt hatte, beginnt, wann es endet, oder ob es noch existiert. Nicht einmal ein Begriff auf die Begriffsgeschichte hilft. Nützt es zu wissen, dass die erste Erwähnung des Begriffs in einem Text steht, der bereits 1870 von John Chapmann geschrieben wurde, der ihn für eine besondere Art der Malerei benutzt? Dass der Begriff zu Beginn der 1930er Jahre als Beschreibung für spanisch-lateinamerikanische Literatur genutzt wird? Oder dass der amerikanische Literaturwissenschaftler Leslie Fielder den Begriff in einem Artikel nutzt, in dem es darum geht, die Grenze zwischen Hochkultur und Popkultur einzureißen. Der Text erschien passender Weise 1968 zunächst in der deutschen Christ und Welt und ein Jahr später in komprimierter Form im amerikanischen Playboy. Passender hätte man einen solchen Text kaum umsetzen können. Aber ist das dann schon postmodern?
Was genau er selber unter Postmoderne verstand, schrieb der amerikanisch-ägyptische Literaturtheoretiker Ihab Hassan 1973 auf. Für ihn besteht diese Postmoderne aus elf Elementen, unter die er etwa die Unbestimmtheit von Wissen und Gesellschaft, eine Fragmentarisierung, Performanz und Teilnahme oder auch den Konstruktionscharakter der Postmoderne packt. Der britische Literaturhistoriker Terry Eagleton, der als Kritiker der Postmoderne gilt, beschreibt den Charakter der Postmoderne ähnlich, wenn er sagt, dass die Postmoderne eine intellektuelle Strömung sei, „die misstrauisch ist gegenüber den klassischen Begriffen von Wahrheit, Vernunft, Identität und Objektivität, von universalem Fortschritt oder Emanzipation, von singulären Rahmenkonzepten, großen Erzählungen oder letzten Erklärungsprinzipien“. Stattdessen betrachtet die Postmoderne die Vorstellung, dass die Natur der Dinge einfach gegeben sei, als skeptisch.
Der französische Philosoph Jean-François Lyotard, der als einer der führenden Denker der Postmoderne galt, schrieb in seinem Standardwerk Das postmoderne Wissen zu dem davon, dass die Vertreter der Postmoderne „den Akzent auf die Gegebenheiten der Sprache [legen] und darin auf ihren pragmatischen Akzent“. Das bezeichnet er als Sprachspiele.
Literaturwissenschaftler, Philosophen, ein Maler äußern sich zur Postmoderne seit etwa 150 Jahren. Es steht demnach wohl außer Frage, dass es um eine intellektuelle Strömung geht. Seit dem Beginn des 21. Jahrhundert ist sie ein wenig aus dem Fokus geraten, doch liegt das vielleicht daran, dass wir uns mittlerweile an vieles von dem gewöhnt haben, was seit dem Ende der 1960er Jahre passiert ist.
Und so ist es sicherlich kein Zufall, dass Leslie Fielders Artikel in dieser Zeit entstand, in der sich die Studentenbewegungen in den USA und Europa, elektrisiert durch den Vietnamkrieg, die Bürgerrechtsbewegung und die Auseinandersetzung mit der Nazidiktatur, aufmachten, die Welt zu verändern. 1969 passierte dies in Deutschland intellektuell durch die Frankfurter Schule von Theodor Ardono und Max Horkheimer, aber auch politisch durch die erste sozial-liberale Regierung unter Kanzler Willy Brandt, der unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ gesetzliche Veränderungen veranlasste, für die betroffene Gruppen seit Jahrzehnten gekämpft hatten. Erinnert sei dabei etwa daran, dass Frauen bis in die 1970er Jahre hinein nicht ohne Erlaubnis ihres Ehemanns arbeiten durften.
Die Moderne hielt Einzug in die Gesellschaft und gleichzeitig kam auch endlich ans Licht, was in der Moderne alles schief gelaufen war. Die Aufarbeitung der NS-Verbrechen und des Stalinismus, die expansive Politik der USA in Südostasien, Lateinamerika und im Nahen Osten machte klar, dass die Geschichte, die, seit sie als kritische Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert entwickelt worden war, immer als eine teleologischen, also zielgerichtete, Erzählung angesehen wurde, als solche nicht mehr gelten konnte. So suchte die Geschichtsschreibung nach neuen Wegen und fand sie in der Theoriebedürftigkeit, an die Golo Mann nicht glaubte, wie er in einem Debattenbeitrag schrieb.
Doch wenn diese Erzählung der Geschichte nicht stimmte, dann stimmten vielleicht auch andere Dinge nicht. So machten sich vor allem französische Intellektuelle auf, herauszufinden, was alles falsch lief in den modernen Zeiten. Derrida, Foucault, Satre, Baudrillard, Latour, sie alle arbeiteten und zum Teil arbeiten sie noch daran, die Konstruktion der Welt herauszufinden und sie dort, wo es nötig erscheint zu dekonstruieren. Und ihre Epigonen tun dies auf den Lehrstühlen der Universitäten der Welt bis heute. Allerdings muss ich hier einen Einschnitt machen, denn Welt bezieht sich natürlich auf die westliche Welt. Nur in Staaten, in denen der Kampf um das Überleben durch ein gefestigtes Rechtssystem, funktionierendes Staatswesen und eine ausreichende, wie auch immer man das definieren mag, Wohlfahrtfürsorge geregelt ist, kann man sich den Luxus leisten, die Wirklichkeit zu dekonstruieren. Denn darum geht es. Ausgehend von der Dekonstruktion der Geschichtserzählung, werden Wahrheiten, Realitäten, Perspektiven hinterfragt und manchmal durch anderes ersetzt. Dabei sind wunderbare neue Worte entstanden, die alles das Wort -ismus als Nachsilbe aufweisen: Postfeminimus, Postheroismus, Postkolonialismus, Strukturalismus, Dekonstruktualismus, etc. pp.
Wie auch immer man diese Subgenre der Postmoderne bezeichnen will, einig sind sie sich darin, dass alles Mögliche hinterfragt werden muss. Das ist zunächst nicht schlecht, aber allzu häufig vergessen die Theoretiker dabei, sich selbst zu hinterfragen und manchmal schießen sie dabei auch über das Ziel hinaus.
Doch wir müssen noch ein wenig beim Begriff Postmoderne bleiben. Wenn man sich diesen anschaut, dann erkannt man, dass er aus zwei Worten gebaut ist. Neben der Vorsilbe Post- folgt das Wort Moderne. Das erste Worte ist eine lateinische Wendung, mit der man Dinge bezeichnet, die nach etwas stattfinden, das zweite Wort ist eine Epochenbezeichnung, etwa für Kunst oder Architektur. Es liegt nahe, das Wort historisch einzuordnen, und somit die Postmoderne zeitlich hinter die Moderne zu packen, doch es ist auch möglich, das Wort nur theoretisch zu fassen und sie als eine Möglichkeit zu sehen, die Moderne zu überwinden.
Probiert man, die historische Bedeutung des Wortes zu greifen, muss man schauen, wann die Moderne genau war, denn nur dann lässt sich die Postmoderne begreifen. Gemeinhein versteht man unter dem Begriff der Moderne ein Zeitalter, das irgendwann im 18. Jahrhundert begann, also als Philosophen über die Menschenrecht nachdachten, Ingenieure die Dampfmaschine erfanden und ausbauten, das Bürgertum sich in Kaffeesalons traf, um über Kunst, Literatur und Naturwissenschaften nachzudenken, als Australien als letzter Kontinent von den Europäern in Besitz genommen wurde, die Naturwissenschaften begannen, die Welt zu erklären, kurz als alles das begann, von dem wir heute noch profitieren. Der Chemienobelpreisträger Paul Cruzon möchte in dieser Zeit sogar das Anthropozän beginnen lassen, das Erdzeitalter der Menschen, die ab dann begannen, ihre Umwelt mehr zu verändern, als die Umwelt sie.
Aus dieser Zeit entwickelten sich die großen Städte Europas, die Massenproduktion, die Elektrifizierung, aber auch die Verelendung der Massen, die Soziale Frage, der Kolonialismus, die industrielle Verarbeitung von Produkten, die Idee des Marktes, die Globalisierung, das Antibotikum, der Kubismus, die Psychoanalyse, der Marxismus, die Rockmusik, der Film und nicht zuletzt der Computer, das Internet und die Digitalisierung. Und weil ab diesem Zeitpunkt alles besser wurde, begann auch der Mensch damit, die Zukunft als etwas zu sehen, was positiv war. War für den Mensch des Mittelalters noch klar gewesen, dass die Zukunft in der Wiederkehr von Jesu Christus und dem Jüngsten Gericht bestand, das man sehnlichst herbeiwünschte, um aus dem Jammertal der Welt herauszukommen, war ab dem 18. Jahrhundert der Mensch das Maß der Dinge, oder um es mit den Worten des britischen Philosophen Alexander Pope zu sagen: „Das wirkliche Studienobjekt der Menschheit ist der Mensch.“
Aber diese Zukunftserzählung bekam nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs Risse, die sich durch das, was die Siegermächte in den folgenden Jahrzehnten machten, noch größer wurden. Und so setzt die Postmoderne historisch eben dort ein: In den 1960er Jahren.
Auf der theoretischen Ebene muss die Vorsilbe Post allerdings ein wenig anders definiert werden. Im Allgemeinen bezeichnet diese einen Idee, bei der es darum geht, etwas Hergebrachtes neu zu denken oder sogar zu überwinden. Die Vorstellung des Postkolonialismus etwa bezeichnet nicht nur die Zeit nach dem Ende der Kolonien, sondern beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit koloniales Denken auch ohne Kolonien existiert. Das führt dann zu der scheinbaren seltsamen Vorstellung, dass man postkoloniale Spuren nicht nur zeitlich nach dem Ende der Kolonien finden kann, sondern auch zeitlich vor den Kolonien, etwa wenn man sich damit auseinandersetzen will, wie das Verhältnis des mittelalterlichen Menschen in Europa zu denen in Afrika war.
Ähnliches gilt für die Idee des Postfeminismus, die in den 1980er Jahren aufkam. Die Vorsilbe Post hatte hierbei die Intention den Feminismus neu zu definieren, der insofern erfolgreich war, als dass gesetzlich schon nahezu jede Art von Gleichstellung erreicht war, dieser aber noch die gesellschaftliche Akzeptanz fehlte. In diesem Zusammenhang wurden dann auch alte Definitionen von Feminismus überdacht, verändert oder sich von ihm gelöst. Lustigerweise wollten die Denkerinnen jener Zeit durch die Verwendung des Wortes Postfeminismus den Feminismus aus der Verbindung zur Postmoderne und anderen Post-Strömungen lösen, was weder durch die sprachliche Nähe, noch inhaltlich gelang. Postkoloniale Spuren, von denen man sich auch lösen wollte, fanden sich etwa in den Überlegungen afrikanischer Denkerinnen, die die Konzepte des Feminismus als weiß und westlich kritisierten und nichtwestliche Frauenrollen in den Überlegungen vermissten. Die Unbestimmtheit des Begriffs zeigte sich dann aber auch darin, dass neben dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem Feminismus durch anders denkende Feministinnen gleichzeitig eine Bewegung aufkam, die den Postfemininismus nutzte, um einen Antifeminismus zu erklären. Dabei ging es darum, dass dem Feminismus die Schuld an vielen Problemen der Frauen zu geschrieben wurde.
Nun kann man zurecht fragen, was das denn alles soll? Das bis hierher erklärte ist ja vielleicht interessant, aber was haben akademische Fachdiskurse mit unserer Welt zu tun? Inwieweit ist es vorstellbar, dass diese Eifenbeinturmspinnereien eine Rückwirkung auf uns haben. Ich möchte an dieser Stelle an eine recht eindrucksvolle Szene aus dem Film „Der Teufel trägt Prada“ erinnern. In dieser Szene erklärt die Chefredakteurin des Modemagazins die Funktion der Haute Couture. Ein Modedesigner entwickelt einen Schnitt, eine Farbe, eine Kombination aus beidem, stellt diese Innovation vor, die Zeitschriften berichten, andere lassen sich inspierieren und nach und nach, wenn der Designer selbst schon nicht mehr darüber nachdenkt und längst an etwas Neuem sitzt, dann finden sich billige Versionen seiner Idee in den Wühltischen der Kaufhäuser wieder.
Und mit diesem beinahe schon postmodernen Beispiel, bei dem ich einen akademischen Diskurs durch einen populären Film, der sich mit dem Leben der Elite und ihrer Verachtung für den Pöbel beschäftigt, erkläre, sollte klar geworden sein, worum es geht.
Was in den 1960er Jahren begann, sich in den 1970er Jahren theoretisch festigte, sich in den 1980er Jahren entfaltete und in den 1990er Jahren in voller Blüte stand, ist mittlerweile, so scheint es jedenfalls, wieder verschwunden, findet sich aber noch immer in den Wühltischen des öffentlichen Diskurses wieder. An ein paar Beispielen möchte ich das gerne illustrieren.
Beginnen möchte ich mit dem Geschichtsunterricht. Wer sich von Ihnen noch an diesen erinnert, der wird dabei stets vor Augen haben, dass dieser fast immer dadurch geprägt ist, dass der Lehrer etwas über längst vergangene Politik berichtet hat. Dabei gibt es einen roten Faden, der einem im Referendariat immer wieder eingehämmert wird: Der Gegenwartsbezug. Dabei geht es schlicht darum, den Menschen zu vermitteln, warum etwas Altes auch heute noch interessant sein kann. Damit macht sich der Geschichtsunterricht kleiner als er ist, denn etwas kann ja auch interessant sein ohne dass es eine Bedeutung hat – anders lassen sich die hohen Klickzahlen von Katzenvideos bei Youtube und ähnlichen Plattformen kaum erklären. Darüber hinaus aber soll durch den Gegenwartsbezug auch das Demokratieverständnis der Schüler gefördert werden. Das führt dazu, dass der Geschichtsunterricht sehr auf das Politische, also auf das Handeln der Mächtigen eingeengt wird. Soziale Bewegungen, kulturelle Strömungen kommen dabei dann nur in den Blick, wenn sie eine Wirkmächtigkeit hatten, die später, also in einer anderen Epoche, für das Politische noch wichtig geworden ist. So erklärt es sich, dass die Soziale Frage zur Zeit der Industriellen Revolution in den Blick kommt, weil sich als Antwort darauf der Kommunismus ergab, der ja dann im 20. Jahrhundert für die Politik des Westens als Antipode große Relevanz hatte, aber etwa die Katharer, die als religiöse Bewegung des Mittelalters ihren ganz eigenen Reiz haben, aber durch die komplette Auslöschung durch das Papsttum keinerlei Wirkmacht hatten, im Schulunterricht nicht vorkommen. Es ist natürlich sinnvoll die wenige Zeit, die man für den Geschichtsunterricht zur Verfügung hat, nicht zu überfrachten und Material durch didaktische Reduktion zu strafen. Zudem freuen sich Lehrer, wenn sie Vorgaben haben, die den praktischen Alltag an der Schule vereinfachen. Dennoch muss man festhalten, dass dadurch eine Erzählung entsteht, die zum einen sehr auf das Politische blickt und zum anderen eine Fortschrittsgeschichte ist, bei der alle historischen Ereignisse auf ein Ziel hinzulaufen scheinen.
Unterstützt werden solche Vorstellungen von Forschern, die solche Fortschrittserzählungen untersuchen und dabei dann zum Beispiel herausarbeiten, dass es so etwas wie einen deutschen Sonderweg gab, der nur zu Auschwitz hatte führen können, weil Deutschland eine verspätete Nation war, und die Demokratie hier noch später eingeführt wurde. Das führt dazu, dass man eben von solch einer zusammenhängenden Geschichte ausgeht, was sich im Namen des Faches natürlich bemerkbar macht.
Dass eine solche Erzählung mangelhaft ist, Lücken aufweist und manchmal sogar falsch sein kann, versteht sich von alleine. Es war daher sehr gut, dass die Denker der Postmoderne damit begannen, solche Erzählungen zu hinterfragen und dabei die Moderne, in der solche Erzählungen entstanden, gleich auch auf den Prüfstand hoben. Allerdings war das, was sie dabei machte, allerdings keineswegs neu. So hatte der mittelalterliche Philosoph Pierre Abelard bereits durch sein Werk Sic et non die Erzählungen der Bibel und der Kirchenväter gegeneinander gestellt, die dabei zum Teil widersprüchlichen Aussagen hervorgehoben und frech gefragt, was denn nun wahr sei. Er war sozusagen ein postmoderner Denker des Mittelalters. Aber das nur nebenbei. Durch dieses Neudenken der großen Erzählungen brachen diese auseinander. Die einzelnen Teil wurden dadurch sichtbarer und konnten neu zusammen gesetzt werden.
Wie aber ging das von statten? Dazu muss man sich die politische Richtung aus der die postmodernen Denker kamen vor Augen führen. Es versteht sich von alleine, dass Menschen, die etwas radikal Neues wollen, eher selten im Lager der Konservativen zu finden sind. Der Progressivismus ist von jeder ein Zeichen des linken und des liberalen Spektrums des politischen Lagers gewesen und aus dieser Ecke kamen dann auch die postmodernen Denker. Dabei hatten Sie nur ein Problem. Auch die Marxisten hatten eine Geschichtserzählung des Fortschritts, die ihnen von Marx und Engels einleuchtend vor Augen geführt worden war. Der Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrücker, der Besitzlosen gegen die besitzende Klasse war genauso eine Meistererzählung wie es die Nationalgeschichten oder das Fortschrittsnarrativ des Westens war. Wenn man daher die Postmoderne ernst nehmen wollte, dann musste man auch damit anfangen, diese linke Großerzählung zu hinterfragen. Da aber zum Glück die Postmoderne eher ironisch als ernst gemeint ist, konnten die Denker problemlos links sein und den Marxismus nicht zerlegen. Einzig Marxisten wie Terry Eagleton erkannten, dass die Postmoderne auch für die linke Sache gefährlich werden konnte und griffen diese daher an. Der für das linke Lager typische Spaltpilz machte auch in der Postmoderne nicht Halt.
Wenn aber die Postmoderne aus der linken Ecke kam, dann versteht sich, dass das Soziale für ihre Position eine entscheidende Rolle spielte. Während sich die Moderne auf die Machtgeschichte gestürzt hatte und die Erzählungen von Politik und Bürgertum schrieb, rückten für die Postmodernen diejenigen in den Blick die außerhalb davon standen. Zunächst waren das die Arbeiter und all jene, die aus der Gesellschaft ausgegrenzt waren. Menschen mit psychischen Störungen gehörten dazu, aber auch Häftlinge, Migranten und Frauen. Die gesellschaftlichen Minderheiten waren bestimmend, selbst dann wenn sie, wie im Fall der Frauen, eine Mehrheit darstellten, wenn man nur auf die Zahlen blickte.
Die amerikanische Historikerin Donna Harraway fasste diesen Umstand gut zusammen als sie schrieb, dass man sich zunächst um die Arbeiter, dann um die Frauen, dann die Migranten kümmerte und in einem nächsten Schritt die Tiere als Akteure in den Blick geraten müssten. Das Wort Akteur war dabei ein entscheidendes Wort. Denn da die Geschichtserzählungen ja einem Ziel folgten, das zwangsläufig zu einer Katastrophe oder zu einer besseren Welt führen musste, waren die einzelnen in dieser Erzählung auftretenden Menschen nur Statisten, aber keiner von ihnen war in der Lage den Lauf der Welt anzupacken. Die Postmoderne aber holte den Menschen (mittlerweile auch die Tiere), also das Subjekt in den Mittelpunkt und lies ihn zum Akteur werden.
Die Postmoderne wurde damit ungewollt zur idealen intellektuellen Basis für eine weitere Bewegung, die sich in den 1980er Jahren auf den Weg machte, den Lauf der Welt zu verändern. Die Wahlerfolge von Margaret Thatcher und Ronald Reagan sowie später von Tony Blair und Gerhard Schröder ließen den Neoliberalismus politisch hochkommen, der eben auch davon ausging, dass, um die Eiserne Lady zu paraphrasieren, es keine Gesellschaften, sondern nur Individuen gebe.
Es verwundert daher wenig, wenn gerade in den Bereichen, in denen der Kapitalismus am wichtigsten ist, etwa in der City of London, die Idee der Toleranz gegenüber Individuen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion hoch ausgeprägt ist.
Das Individuum als Akteur ist aber dort am stärksten, wo es nicht Teil der Mehrheit ist. So wurden Minderheiten auf einmal wichtig und interessante Forschungsobjekte. Teil einer Minderheit zu sein, sorgt aber auch dafür, dass man sich mit der Mehrheit auseinandersetzen muss. Eine solche Auseinandersetzung erfolgt durch Abgrenzung und Abgrenzung erzeugt Streit. Streit hat Täter und Opfer zur Folge und nur die Minderheit, die sich dem Druck der Mehrheit beugen soll, kann Opfer sein. Da aber Täter in den meisten Fällen auch Gewinner sind, sind die Verlierer die Opfer, Opfer verdienen unsere Sympathie und man muss ihnen helfen. Dann ist es natürlich hilfreich zu schauen, was genau sie zu Opfern machte und dabei konnte man wunderbar auf diejenigen Denker zurückgreifen, die alles für Konstruktion hielten. Was aber konstruiert ist, kann man auch zerstören. Der Denkfehler, der dabei auftaucht, ist Ihnen sicherlich aufgefallen. Wenn man sich zunächst von der Macht und ihren Erzählungen abwandte, um über die Arbeiter zu schreiben, dann beschäftigt man sich rein von den Zahlen her gar nicht mit einer Minderheit, sondern ganz klar mit der Mehrheit. Die elitäre Minderheit des Bürgertums war aber maßgeblich für die Entwicklung der westlichen Welt. Diese Minderheit ist damit natürlich keinesfalls ein Opfer, sondern Täter. Beschäftigt man sich aber mit der Mehrheit der Gesellschaft, zum Beispiel den Arbeitern, dann ist es nicht mehr so einfach, diese zu Opfern zu machen. Diesem Paradox entkamen die postmodernen Denker dadurch, dass sie Arbeiter zunächst ignorierten und sich tatsächlichen Minderheiten zuwandten, etwa den Migranten oder den Schwulen.
Das auch diese zum Repertoire der Postmoderne gehörten erklärt sich aus dem Umstand, dass zum Akteur auch immer der Körper gehört. Dieser wurde in den Überlegungen der Postmoderne zu einem Bezugspunkt eigener Größe. Denn schon der römische Schriftsteller Sallust wies daraufhin, dass der Mensch durch seinen Körper zum einen ein Gott, zum anderen ein Tier sei. Diese Dichotomie des menschlichen Körpers zwang die postmodernen Denker zu einigen Gedankenspielen. Denn während es für einen Naturwissenschaftler recht klar ist, dass der Mensch Teil der Natur ist, ist diese Vorstellung für einen Kulturwissenschaftler diskutabel. Ein Feld, in dem sich dieser Streit besonders hart austrug, war der Streit um das Geschlecht. Die Moderne hatte dem Geschlecht Stereotypen zugeordnet und diese mit der Evolutionsgeschichte verknüpft. Zum Teil kann man bis heute davon hören, dass Frauen oder Männer so sind, wie sie sind, weil in der Steinzeit dies und jenes geschehen war, was dazu geführt hatte. Ein schönes Beispiel ist dabei die Idee vom Jäger und der Sammlerin. Der starke Mann übernimmt die Jagd, die schwächere Frau das Sammeln von Beeren. Doch schon diese an sich einleuchtende Idee stößt auf ein Problem. Uns allen ist doch klar, dass es auch groß gewachsene, starke Frauen gibt und kleine, eher schwächere Männer. Und es sollte auch klar sein, dass dies auch in der Steinzeit so gewesen sein muss, denn wenn dem nicht so war, warum gibt es das heute, wenn die Geschlechtsrollen doch seit der Steinzeit definiert sind. Es wäre doch geradezu dumm gewesen, den schwachen Mann auf die Jagd mitzunehmen und die starke Frau zum Sammeln zu verdonnern, nur weil sie eine Frau ist. Eine solche Unterscheidung hätte die Gruppe unserer beispielhaften Vorfahren sicherlich nicht lange überlebt.
Die Natur oder Entwicklungsgeschichte als Argument zunehmen erscheint in unserem simplen Beispiel schon problematisch. Und so passierte es, dass die Denker der Postmoderne, allen voran die amerikanische Philosophin Judith Butler das natürliche Konzept von Mann, Frau und Geschlecht als solches hinterfragten und im Ergebnis dazu kamen, dass es so etwas eigentlich nicht geben kann. Und wenn es das nicht gibt, dann sind alle Stereotypen kulturell und es ist möglich, das Geschlecht zu dekonstruieren, es zu öffnen und dazwischen hin und her zu wandeln. Das Ergebnis dieser Überlegungen findet sich unter anderem bei Facebook, wo es unzählige Möglichkeiten gibt, ein Geschlecht auszumachen, oder bei Twitter, wo neulich ein User bemerkte, dass in er das Gefühl habe, innerhalb eines Jahres sei ein Großteil seiner Freunde alle transsexuell geworden. Bedenken wir dabei aber, dass die Postmoderne ein großes Spielfeld ist, das durch Sprachspiele und Ironie gekennzeichnet ist.
Aber auch dabei entsteht ein Problem: Ein Spiel ist irgendwann vorbei und es wird ernst. Irgendwann muss man sich entscheiden, Verantwortung übernehmen und vielleicht ist es ein Zufall, dass wir in einer Zeit leben, in der man endlos spielen kann, aber sich vor den Konsequenzen seiner Handlungen drückt und niemand mehr Verantwortung übernehmen will, weder in Vereinen, in der Politik oder bei der Arbeit. Vielleicht ist es auch kein Zufall und die das Spielen der Postmoderne ist zu unserem Alltag geworden.
Anderseits gibt es auch Vertreter der Postmoderne, die es geschafft haben, dem Spiel zu entkommen und in einem heiligen Ernst die Erkenntnisse ihrer Überlegungen in die Welt tragen, in der Hoffnung sie zu einem schöneren Platz zu machen. So werden die von Lyotard als essentiell für das postmoderne Wissen aufgeführten Sprachspiele zum politischen Ernst, wenn immer wieder behauptet wird, dass Worte die Realität prägen und man nur die Wortwahl ändern müsse, um die Realität zu verbessern.
Beispiele dafür gibt es sonder Zahl. Das Mitbenennen der weiblichen Form, wenn man ein Publikum adressiert ist ein Klassiker dieser Idee. Da der Plural immer grammatisch männlich ist, prägt die männliche Form unser Denken und wir assoziieren ein bestimmtes Publikum, wenn wir von Schülern oder Teilnehmern sprechen. Schon meine Mutter hatte immer moniert, dass eine Gruppe von 99 Frauen automatisch männlich wird, wenn ein Mann dazu kommt. Das es sich dabei um ein sprachliches Problem handelt ist nachvollziehbar, allerdings entstehen bei der Lösung neue Probleme. Was zum Beispiel tut man, wenn man drei Personen vor sich hat und diese als Menschen adressieren will, die teilnehmen? Teilnehmer wäre der männliche, traditionelle Begriff, aus dem nicht hervorgeht, ob es Männer sind, Frauen und Männer oder nur Frauen. Teilnehmerinnen würde traditionell auf ein rein weibliches Publikum hindeuten, könnte aber auf progressive Weise jetzt auch die Männer meinen. Die sich mittlerweile etablierte Kompromisslösung Teilnehmer und Teilnehmerinnen, würde bei drei Personen nicht funktionieren, weil es entweder zwei Frauen und ein Mann oder zwei Männer und eine Frau wären. Man könnte in die Partizipation ausweichen und von Teilnehmenden reden, doch damit ist ja rein sprachlich gemeint, dass jemand jetzt teilnimmt. Geht aber eine oder einer der Teilnehmenden auf die Toilette, wäre er oder sie gar kein Teilnehmender mehr. Ich könnte natürlich auch darauf ausweichen von Personen zu sprechen, die teilnehmen und würde dann später von denjenigen berichten, die teilgenommen haben, teilnahmen oder teilgenommen hatten oder bei der Planung einer Veranstaltung von denjenigen, die teilnehmen werden. In allen Fällen sorgt diese Diskussion dafür, dass ich mich intensiv mit Sprache auseinandersetze, dass es dabei aber in der Intention um das Sichtbarmachen von Frauen ging, wird vergessen.
Doch längst ist die Unterscheidung zwischen Mann und Frau ja durch die postmoderne, wie oben angedeutet, in Frage gestellt. Wer sich sprachlich nun an eine Gruppe von Menschen wendet, muss schriftlich ein Sternchen oder einen Tiefstrich verwenden oder eine bewusste Pause zwischen der Teilnehmer und -innen setzen. Man merkt aber schnell, dass man zwar die Frauen durch das bekannte -innen nun gut betonen kann, aber dieses Pause kaum als adäquate Lösung zur Sichtbarmachung von irgendetwas wirkt. Wann wäre auch ein Schweigen, und nichts anderes ist eine Pause, je ein gutes Zeichen gewesen, etwas Hervorzuheben – außer Desinteresse und Verachtung.
Und obwohl es all diese Überlegungen gibt, halten postmoderne Aktivsten daran fest, dass über Sprache Realitäten verändert werden können. Auch der umgekehrte Weg ist ihnen klar bewusst. Sonst würde es nicht immer wieder neue Diskussion darüber geben, welche Worte was bezeichnen können ohne die Bezeichneten zu diskriminieren. Auch dazu ein Beispiel, dass in diesem Jahr Wuppertal beschäftigt hat: Die Umbenennung der Mohrenstraße in Heckinghausen.
Das Beispiel mag seltsam anmuten und doch wird daran vieles deutlich, was die Postmoderne auszeichnet. Zunächst muss natürlich klar gemacht werden, dass Sprache das Potenzial hat, Menschen zu verletzen. Das geht auf einen direkten Weg, dann ist die Verletzung seelischer Natur. Das geht auch auf einem indirekten Weg, wenn ich jemanden durch Sprache dazu bringe einen dritten oder sich selbst zu verletzen. Sprache kann also schädigen. Nicht umsonst hat das deutsche Strafrecht Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung und Volksverhetzung aufgeführt. Der Grad der Schädigung aber ist davon abhängig, wie sensibel der Beleidigte ist.
Insofern ist eine Gruppenbeleidigung nur schwer möglich, da innerhalb einer Gruppe verschiedene Individuen existieren, von denen einige sich beleidigt fühlen könnten, andere wiederum nicht. Nun ist aber, wie ich erwähnt hatte, der Körper für die Postmoderne ein wichtiger Inhalt. Dieser Körper wird nicht nur durch sein Geschlecht definiert, sondern zum Beispiel auch über die Stärke der Pigmentierung seiner Haut. Wie also man durch das Geschlecht zwei Gruppen bilden kann, die dann diejenigen, die sich zu keinem dieser beiden zugehörig fühlen, ausschließen, so kann man durch Hautfarbe Gruppen bilden und beginnen diesen Eigenschaften zuzuschreiben, die jenseits der Hautfarbe liegen. Beispiele für solche Gruppeneigenschaften jenseits dessen, was die Natur dem Menschen gegen hat, sind wohl bekannt. Frauen haben nicht nur eine Vagina, sondern sie seien auch kommunikativer. Männer besitzen nicht nur einen Penis, sondern könnten besser räumlich denken. Man mag von diesen Zuschreibungen halten was man will, aber es gibt sie und wenn eine Frau dann mal eher wenig sagt, oder ein Mann beim Einparken Hilfe braucht, fällt es als von der Norm abweichend auf.
Solche Zuschreibungen gibt es aber nicht nur für Geschlechter, sondern eben auch für Hautfarben, Nasen- und Augenformen etc. Asiaten seien besser in Mathematik, Indianer seien sehr naturverbunden, Afrikaner seien Frohnaturen. Ich bin mir sicher von der ein oder anderen dieser Dinge haben Sie schon gehört. Dass es sicher auch ein ein oder anderen Koreaner gibt, der Mathe hasst, Indianer gibt, die nicht zu Naturgeistern sprechen, sondern Unternehmen führen, deren CO2-Bilanz über dem Verträglichen liegt und depressive Afrikaner, ist uns allen nur zu bewusst, das ändert aber kaum etwas daran, dass es diese Stereotypen gibt.
Sie haben sicherlich bemerkt, dass ich ausschließlich positive Beispiele für Gruppeneigenschaften gewählt habe. Was negative Eigenschaften angeht halte ich mich hier zurück, aber das es auch solche gibt, sollte allen klar sein. Aber egal ob positiv oder negativ: Wenn ich einer Person aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit Eigenschaften zuspreche, die ich mit dieser Gruppe verbinde, dann sehe ich das Individuum nicht als eigenständiges Subjekt, sondern als Objekt innerhalb einer Gruppe. Für die Postmoderne ist das etwas Ungehöriges.
Was hat das nun mit der Mohrenstraße zu tun? Es geht dabei vor allem um das Wort Mohr. Diejenigen, die sich für eine Umbenennung aussprechen, argumentieren, dass dieses Wort rassistisch sei. Die Begründung dafür liegt, so etwa der Wuppertaler Politikwissenschaftler Muyisa Muhindo, in der Tatsache, dass das Wort sich vom lateinischen Wort maurus ableite, was zum einen dunkel oder schwarz bedeute und sich zum anderen seit dem 16. Jahrhundert als allgemeine Fremdbezeichnung für schwarze Menschen etablierte. Das sei aber auch genau die Zeit gewesen, in der sich der pseudowissenschaftliche Rassismus entwickelte. Dadurch ergebe sich, so Muhindo eine unmittelbare Verflechtung des Begriffs Mohr mit rassistischen Ideen. Das ist gut postmodern argumentiert. Im Detail wird ein Wort genommen, dekonstruiert, neu kontextualisiert und so ein Argument gesetzt. Das Problem daran ist nur: Alle drei Ausgangslagen sind faktisch falsch.
Das Wort Mohr leitet sich zwar vom Lateinischen ab, bedeutet aber nicht schwarz, sondern ist eine Bezeichnung der alten Römer für die Bewohner Mauretaniens, womit Berbervölker gemeint sind. Der Begriff ist eventuell sogar eine Eigenbezeichnung, die von den Römern übernommen wurde. Zudem wird das Wort Mohr bereits in der Literatur des Mittelalters für Menschen benutzt, die schwarz sind und etabliert sich nicht erst im 16. Jahrhundert. Und der pseudowissenschaftliche Rassismus ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, was Muhindo auch einräumt, denn er zitiert als Erklärung für diesen Immanuel Kant, der sicherlich nicht im 16., sondern im 18. Jahrhundert lebte. Ist der Begriff Mohr damit nun rassistisch oder nicht? Fest steht, dass das Wort eine Beziehung zu den Menschen Afrikas hat. Fest steht auch, dass es eine Bezeichnung ist, die im Laufe der Zeit auf die Bevölkerung des Afrikas jenseits der Sahara übergegangen ist. Zudem ist auch klar, dass das Wort in Texten benutzt wurde, in denen über Menschen afrikanischer Herkunft gehetzt wurde. In diesen Texten aber findet sich auch das Wort Neger und am häufigsten das Wort Schwarzer. Interessanterweise ist dieses letzte Wort, das etwa von Kant zur Beschreibung seiner Rassentheorie im Übermaß genutzt wird, in dem Artikel Muhindos fast immer groß geschrieben, auch da, wo es als Adjektiv genutzt wird. Der Grund dafür liegt in einer Symbolik, die von afro-deutschen Aktivisten erfunden wurde. Die Schreibung des Wortes schwarz mit einem großen S soll zeigen, dass es sich um einen politischen Begriff handelt, der von diesen Aktivsten aktiv genutzt wird, um eine Politik für die Gruppe zu machen, der sie sich verbunden fühlen. Ich wäre ja der Meinung, dass man statt solcher typologischen Spielereien auch einfach ein solch ambivalentes Wort wie Mohr nutzen könnte, um eine politische Botschaft zu setzen. Stattdessen wird aufgrund von historisch falschen Argumenten probiert, ein Wort zu verbieten.
Die Postmoderne zeigt sich demnach in der einer solchen Diskussion gleich doppelt. Es geht zum einen um den eigenen Körper und dessen Selbstbestimmung, zum anderen wird probiert, durch Dekonstruktion zu argumentieren. Die Ambivalenz des Begriffs, mit der man jedoch ursprünglich hätte wunderbar spielen können, wird dort ausgesetzt, wo es darum geht, politisch auf der richtigen Seite zu stehen. Denn der linke Ursprung der postmodernen Theorie verpflichtet sie dazu natürlich gegen rechtes Gedankengut zu sein.
Es gibt aber auch dabei eine Schwierigkeit, die sich auftut. Wenn, wie ich berichtet habe, der Einsatz für die marginalisierten Gruppen ein Hauptanliegen für postmoderne Aktivisten ist, ist das sicherlich eine gute Sache. Wenn dabei aber diese marginalisierten Gruppen wegen ihrer Opferrolle einen besonderen Status bekommen, der sie wegen ihrer Rolle als Opfer von Unterdrückung und Diskrieminierung über die Täter erhebt, dann passiert etwas sehr Interessantes, auf das rechte Aktivisten mit Vergnügen hinweisen. Dann kann es passieren, dass im Anti-Rassismustraining, das prinzipiell eine gute Sache ist, auf einmal darüber aufgeklärt wird, dass weiße Menschen durch ihre Täterrolle, durch ihre Privilegien per se schlecht sind, dass sie nicht diskriminiert werden können, sie also aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihres Geschlechts – alte weiße Männer ist hier das Stichwort – charakterisiert werden, dann produzieren linke, postmoderne Aktivisten genau so eine Erzählung, die sie eigentlich dekonstruieren wollten.
Wenn rechte Aktivisten dann darauf hinweisen, das, wenn das gleiche nur mit umgedrehten Akteuren passieren würde, man ja wohl von schlimmsten Rassismus sprechen würde, wird diesen oft vorgehalten, als Weiße könnten sie gar nicht in der Lage sein, die Position von Schwarzen zu verstehen. Wenn dann aber ein Betroffener eine Position einnimmt, die nicht zu dem passt, was von den postmodernen Aktivisten erwartet würde, dann ist dieser Betroffene entweder durch das bestehende Narrativ so geprägt, dass er die Wahrheit nicht sieht oder er spricht nur für sich, nicht für andere.
Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass ein Anti-Rassimus-Training oder ein Gender-Workshop im Prinzip nichts bringt, weil die Teilnehmer ja nie wirklich nachvollziehen können, wie es ist, ein Betroffener zu sein.
An solchen Beispielen zeigt sich, warum die Postmoderne zwar in ihren theoretischen Bemühungen durchaus interessante Aspekte hat, die zum Denken einladen. Denn was würde dagegen sprechen sich mehr mit der Geschichte unter Nichtpriviligierten auseinanderzusetzen? Aber in der praktischen Umsetzung dieser Theorien an Grenzen stößt, die Widerstand geradezu heraufbeschwören.
Allerdings ist auch dieser Widerstand postmodern geprägt. Der Soziologe Andreas Rackwitz etwa beschreibt in seinem Werk über die Gesellschaft der Singularitäten eine spannende Entwicklung. Anhand zahlreicher Studien und Untersuchungen führt er aus, dass die Menschen des 21. Jahrhunderts dazu neigen, immer singulärer, also individueller zu werden. Mitgliedschaften in Vereinen, Parteien und Kirchen gehen zurück während der Einzelne sich als etwas Besonderes auf Facebook, Twitter oder Instagram inszeniert. Normal zu sein, ist out, das Besondere ist in. Und zu diesem Besonderen kann es, so Rackwitz, auch gehören, gegen einen als links empfundenen Mainstream zu rebellieren und sich selber als rechts darzustellen. Auf diese Art spiegeln selbst die Rechten die Postmoderne wieder, in dem sie die Idee des Körpers oder der kulturellen Identität übernehmen.
Tatsächlich übernehmen die Rechten aber noch mehr. Der spielerische Umgang mit Texten und anderen Kunstwerken gehört längst zum Repertoire der so genannten Neuen Rechten. Der Kunstwissenschaftler Daniel Hornuff hat in seinem Werk Die neue Rechte und ihr Design auf diesem ästhetischen Angriff hingewiesen, den er im Umweltschutz genauso wieder erkennt wie in der Selbstpräsentation oder den Internet-Memes.
Die Gegner postmoderner Ideen nutzen diese selbe und können ihr so nicht entkommen. Selbst außerhalb der westlichen Welt wird das deutlich. So bezeichnete der britische Terroismusforscher Lawrence Freedman die Anschläge des 11. Septembers 2001 als postmoderne Anschläge, weil das World Trade Center eben ein Symbol für die westliche Welt gewesen ist und kein strategisch-rationales Ziel.
Es ist das Spiel mit Symbolen, Begriffen, mit der Sprache, das dafür sorgt, dass die Postmoderne in unserer Zeit lebendig ist. Durch das Dekonstruieren werden neue Welten und Ideen erschlossen, die die Ambivalenz der Zeit deutlich machen. In der Binsenweisheit, dass die Welt immer komplexer werde, zeigt sich dieses Gefühl allzu deutlich. Die Frage ist aber, ob die Welt tatsächlich immer komplexer wird, oder ob lediglich die Wahrnehmung der Welt immer komplexer wird.
Ein Beispiel für diese Komplexität ist die Globalisierung, also der globale Handel mit Waren und Dienstleistungen. Nur: Diesen Handel hat es schon immer gegeben. Während des zweiten Weltkriegs fand ein australischer Marineoffizier an der Küste seines Heimatlandes ein paar mittelalterliche Münzen aus der Prägestelle von Kilwa in Tansania. In der Antike reisten malaysische Seefahrer nach Madagaskar und ein paar Jahrzehnte vor Kolumbus wurden von Tahiti aus Hühner nach Peru gebracht, die man dort vorher gar nicht kannte. Ist das weniger komplex als der Welthandel heute? Anders ist die Geschwindigkeit und die Informationen, die wir über diese Vorgänge haben.
Diese beiden Dinge sind es aber, die für die Postmoderne entscheidend sind. Informationen braucht man, will man dekonstruieren und Geschwindigkeit ist wichtig, wenn man der erste sein will, denn nur darin zeigt sich ja das Besondere. Der Nachahmer kann nicht besonders sein.
Gleichzeitig sorgen diese beiden Dinge aber auch dafür, dass der Mensch überlastet. Burn-out ist hier das Stichwort. Die Moderne zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen stundenlang, tagelang die gleiche eintönige Arbeit verrichteten und dabei den Kontakt zum Gegenstand verloren, die Postmoderne zeichnet sich durch das genaue Gegenteil aus. Ambivalenzen und Komplexität prägen die Filme und Fernsehserien unser Zeit, die Arbeitswelt fordert Flexibilität und Aufgeschlossenheit für neue Herausforderungen. Doch das überfordert viele Menschen kolossal.
Darin spiegelt sich in der Postmoderne allerdings die Moderne wieder. Die Industrialisierung der Moderne brachte die Menschen dazu sich mit Natur, Geschichte und Heimat zu beschäftigen, sich in die wunderbaren Welten der Romantik zu flüchten, die Digitalisierung der Postmoderne überfordert die Menschen auch, aber anders, aber die Resultate sind die gleichen. Die Mensch von heute flüchtet sich in den Umwelt- und Klimaschutz, interessiert sich für Mittelaltermärkte und seit auf einmal existieren zahlreiche Heimatministerien, während Unternehmen nicht mehr neu und innovativ sein wollen, sondern erkennen, dass sie eine lange Tradition haben, die sie jetzt in der Werbung wieder pflegen.
Viele Mittel werden genutzt, um der Komplexität zu entgehen und wohl kaum einer hätte damit gerechnet, dass irgendwann ein Virus kommt und dafür sorgt, dass die Beschleunigung und Informationsflut stoppt. Corona lenkt unser Denken wieder in ruhigere Bahnen. Das Homeoffice zwingt uns, sich wieder mit unserer Familie zu beschäftigen, der Lockdown sorgt dafür, dass alles ein wenig ruhiger wird. Klare Regeln werden durchgesetzt und in Windeseile durch die Parlamente gebracht. Die Gesundheit wird vom höchsten Gut erklärt, die Ideen der Freiheit und Gleichheit, die wie zwei rivalisierende Geschwister das 20. Jahrhundert bestimmten, sind abgehängt. Und diejenigen, die jetzt fordern, das wir wieder postmoderne Spiele spielen sollten, Ambivalenzen zulassen, ironisch sein sollten, werden mit Ernst verlacht. Ob COVID-19 aber ein Ende der Postmoderne einläutet ist zweifelhaft. Irgendwo in ihrem wirren, ambivalenten, sich widersprechenden Sein wird die Postmoderen auch Platz für das Virus finden, etwa in diesem Witz:
Das Corona-Virus, die Spanische Grippe und die Pest sitzen zusammen in einer Bar. Sie erzählen sich gegenseitig davon wie viele Menschen sie getötet haben. Das Corona-Virus hört den beiden andern aufmerksam zu und widerspricht: „Mein Ziel ist es nicht unbedingt viele Menschen zu töten, sondern mehr viele Menschen für Hygiene und Gesundheit zu sensibilisieren. Da verdreht die Pest die Augen und flüstert der Spanischen Grippe zu: Ah, diese neunmal klugen Millienials!