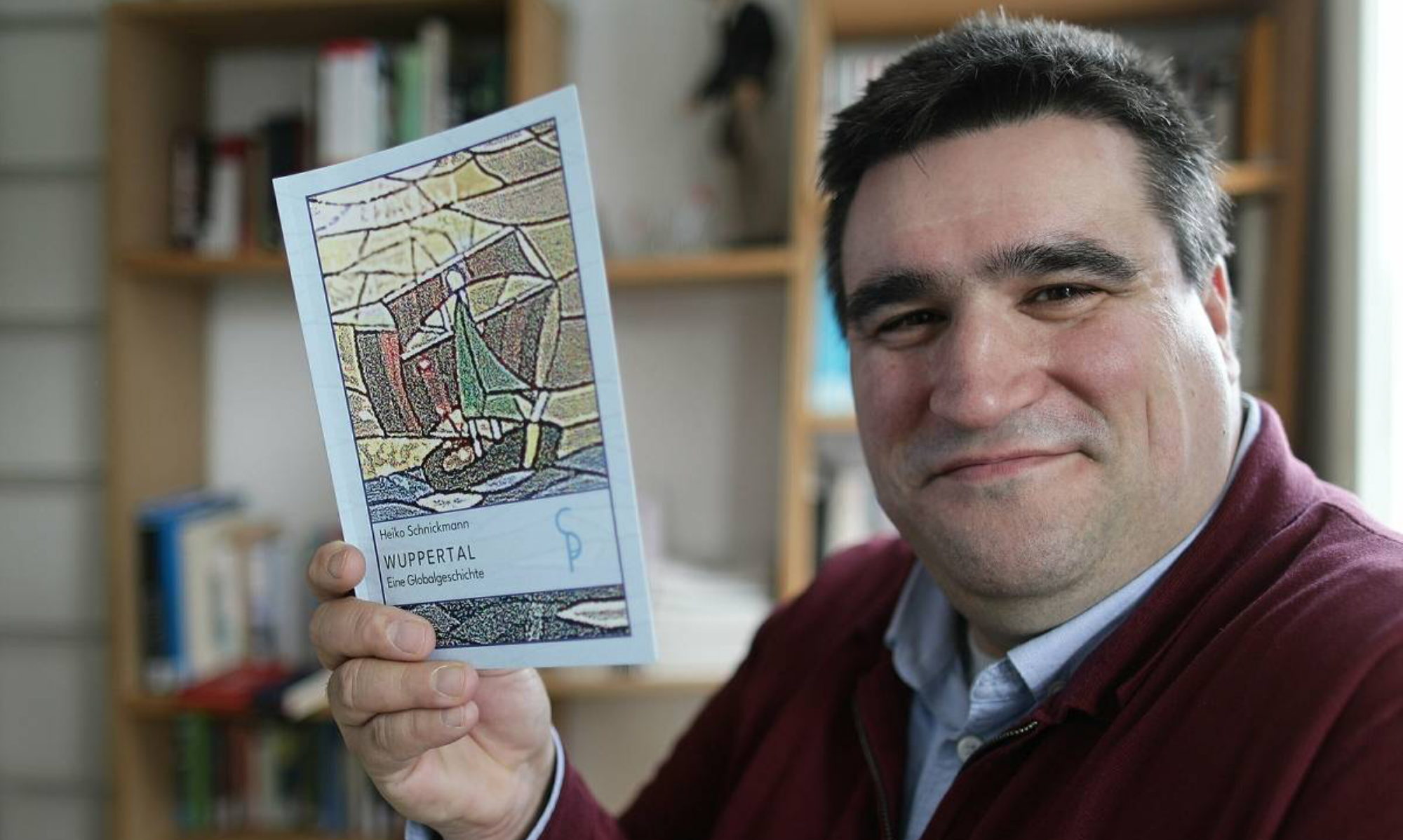Seit der Wahl Donald Trumps ist klar: Wir leben im postfaktischen Zeitalter, in dem mit alternativen Fakten gearbeitet wird. Gleichzeitig lernen wir, dass es Narrative gibt, die den öffentlichen Diskurs genauso bestimmen wie fachliche, etwa in den Wirtschaftswissenschaften oder an der Börse. Ein Narrativ ist eine Interpretation von Fakten. Je nachdem wie man diese präsentiert, kann man ganz andere Geschichten erzählen. Weil aber solche Geschichten das menschliche Bewusstsein prägen, kann man, wenn man weiß, wie man eine Geschichte erzählen muss, um eine gewisse Prägung zu erhalten, die Fakten so darlegen und interpretieren, dass sie richtig geframet werden. Oder kurz: Im postfaktischen Zeitalter framen wir mit alternativen Fakten Narrative zwecks Manipulation der Mehrheit.
Vorher war das natürlich anders. Kein Politiker oder Staatsmann wäre je auf die Idee gekommen, die Fakten zu leugnen und Narrative zu erzählen, in denen Dinge verändert oder gar das komplette Gegenteil erzählt wird. So verlief der Vietnamkrieg für die USA ausnahmslos positiv und der Vietcong hat bekanntlich den Krieg verloren. Auch der Zweite Weltkrieg ist ja bekanntlich von den Deutschen gewonnen worden, so hieß es zumindest im Volksempfänger und in den Wochenschauen, wenn dort noch 1945 von den Siegen der Wehrmacht erzählt wurde. Dieser Krieg war zudem natürlich ein Verteidigungskrieg, denn die Polen hatten ja am 1. September angegriffen, weswegen „ab 5:45 Uhr zurückgeschossen“ wurde.
Genug Polemik: Politik und Lügen, das gehört zusammen. Immer schon. Nicht umsonst gilt für die Geschichtsschreibung der Satz, dass Geschichte von den Gewinnern geschrieben wird. In diesen simplen Ausspruch finden sich zahlreiche Erkenntnisse, die schon vor der Wahl Donald Trumps galten. Erstens: Was erzählt wird, hängt davon ab, wer erzählt. Zweitens: Wie erzählt wird, hängt auch davon ab wer erzählt. Und schließlich drittens: Die Stimmen von einigen kommen in der Erzählung nicht vor.
Diese drei Erkenntnisse kannte man schon, als die kritische Geschichtsforschung begann und sich zur Wissenschaft wandelte. Deswegen lehrt man Studierenden dies gleich im 1. Semester. Eine Quelle muss kritisch gelesen werden. Wer hat sie geschrieben? Warum hat er sie geschrieben? Was erfährt man? Was erfährt man nicht? Diese und andere Fragen sind die Grundlage des Geschichtsstudiums und sie helfen darüber hinaus auch ganz gut, sich in anderen Bereichen, die für den Alltag eventuell relevant sind, zurechtzufinden.
Warum wird aus Trumps alternativen Fakten nun ein postfaktisches Zeitalter? Die Antwort darauf hat damit zu tun, dass öffentliche Narrative von jemandem bestimmt werden. Politiker produzieren jeden Tag Informationen. Pressemitteilungen, Interviews, Konferenzen, Protokolle. Das war schon immer so. Mittlerweile schreiben sie auch auf Twitter, Facebook, Instagram und machen eigene Videos auf Youtube oder anderen Plattformen. Das ist neu. Der Unterschied liegt darin, dass es früher, also vor dieser neuen Medienentwicklung so genannte Gatekeeper, Torwächter, gab, Menschen und Institutionen, die darauf achteten, welche Information wichtig war und was in den öffentlichen Diskurs kommt und vor allem auch was nicht. Durch die oben erwähnten Plattformen haben Politiker die Möglichkeit nun ohne diese Gatekeeper direkt und ungefiltert mit ihren Wählern zu sprechen.
Gleichzeitig haben die Wähler die Möglichkeit den öffentlichen Diskurs direkt und ungefiltert zu prägen. Sie sind nicht mehr nur Empfänger, sie haben auch die Möglichkeit ihre Meinung, oder das, was sie dafür halten, zu verbreiten. Eine Filterung oder Abwägung nach Relevanz findet nicht mehr statt.
Dennoch gibt es weiterhin Gatekeeper und vor allem Leitmedien. Wenn sich die direkte Kommunikation und die gefilterte Kommunikation miteinander verbinden, dann ist das etwas sehr Erfolgreiches. Ein gutes Beispiel dafür ist der Youtuber Rezo, den vor Mai 2019 wohl kaum jemand außerhalb Youtubes kannte. Dann produzierte er ein Video gegen die CDU, das von vielen gesehen wurde, so vielen, dass die Leitmedien darüber berichteten und dann wurde das Video noch öfter gesehen. Im Ergebnis hat der Musiker eines der Videos mit der höchsten Anzahl von Clicks produziert, eine eigene Kolumne bei der Zeit bekommen und kann sich sicher sein, dass jedes Video, das er zu Politik und Gesellschaft produziert, aufmerksam beobachtet wird.
Das Beispiel Rezo zeigt also, was passiert, wenn die neuen Medien und die alten Medien zusammenwirken. Es zeigt aber auch, was passiert, wenn sie gegeneinander arbeiten. Im Jahr 2020 produzierte Rezo ein weiteres Video, in dem es nicht mehr um Politik ging, sondern um die Presse. Das Video hatte nicht mehr so viele Clicks, aber noch genug, um diejenigen, um die es ging, zu ärgern. Während die Bild-Zeitung recht souverän mit diesem einen weiteren Kritiker umging, machte sich die renommierte Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einem eigenen Video daran, Rezos Video auseinander zunehmen. Hauptkritikpunkt: Rezo bewertete die Sachlichkeit und Faktentreue von Medien an deren Umgang mit ihm selber. Davon mag man halten, was man will, doch zeigte sich an diesen Beispielen wunderbar, wie Narrative funktionieren. Während Rezo in einem Artikel einen großen Fehler sah, spielte die FAZ diesen herunter. Am Ende reagierte Rezo auf seine Kritiker mit einem neuen Video und die FAZ resignierte.
Kehren wir zu Donald Trump zurück. Donald Trump hat eine Wahl gewonnen, weil er bzw. sein Wahlkampfteam sich nicht auf die etablierten Medien verließ. Er nutzte Facebook und Twitter, um verschiedenen Personen unterschiedliche Aussagen zu präsentieren. Den etablierten Medien gegenüber war er misstrauisch, denn deren Redaktionen waren, mit Ausnahme von FOX, nicht auf seiner Seite. Sie gehören zu einer anderen Seite des politischen Spektrums.
Vor ein paar Jahren gab es in deutschen Medienhäusern eine Umfrage. Darin wurden Journalisten gefragt, wen sie wählen würden, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahlen wären. Die Antworten überraschten, denn wenn einzig die Journalisten bestimmen würden, wer die Mehrheit im deutschen Parlament hätte, dann wären die Grünen nahe an der absoluten Mehrheit. In deutschen Redaktionen herrscht also tendenziell eher ein links-liberales Milieu vor. Man darf davon ausgehen, dass auch in den Redaktionen der USA vor allem an der Ost- und Westküste dieses Milieu vorherrschend ist. So verwundert es nicht, dass eine Politik, die sich darauf stützt, eine Mauer an die Grenze von Mexiko zu bauen, dort eher auf wenig Gegenliebe stößt, zumal sie von einem Mann kam, der offen einen Kurs fuhr, der sich gegen Intellektuelle richtete, was in den USA aber eine lange Tradition hat. So ist es verständlich, dass sich beide Lager vorwerfen, die Fakten zu verdrehen oder zu lügen. Die Presse wirft dem Präsidenten vor, den Fakten nicht zu vertrauen, der Präsident wirft der Presse vor, Lügengeschichten, Fake News, zu verbreiten. Und plötzlich findet sich der interessierte Leser in einer Zeit wieder, die als postfaktisch gilt, weil nichts mehr als wahr gelten kann. Eine Aussage über die Soziologen nur lachen können, denn sie wissen: So etwas wie Wahrheit gibt es nicht. Es gibt eine Wirklichkeit, deren Interpretation als Wahrheit angenommen wird.
Alles, was der Mensch als wahr annimmt, beruht auf Interpretation. Selbst in den Naturwissenschaften. Dort hat man sich darauf geeinigt, dass bestimmte Testverfahren als aussagekräftig gelten, dass bestimmte Methoden Aussagekraft haben. Aber im Prinzip hängen die Ergebnisse dieser Forschung davon ab, dass man die Grundannahme, dass nämlich jenes Verfahren oder diese Methode als anerkannt gilt, für wahr hält. Wirft man diese Grundannahme aber über den Haufen, dann sind die Ergebnisse plötzlich falsch, oder besser: die Interpretation der Ergebnisse ist falsch. Plötzlich steht das Persönliche im Fokus. Den Wissenschaftlern werden Geldinteressen unterstellt. Wenn sie ihr Modell der gängigen Meinung anpassen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, Fördermittel zu bekommen. Ist das jetzt grundsätzlich falsch? Ist die Erforschung von künstlicher Intelligenz zurzeit nicht beliebter als die Erforschung von Heilmitteln seltener Krankheiten, die nur 100 Menschen auf der Welt haben? Werden dadurch nicht mehr Gelder in die Erforschung künstlicher Intelligenz gegeben als in die Pharmazeutik? Wissenschaftlern Geldinteressen zu unterstellen, ist sicherlich nicht falsch und doch darf man eines nicht vergessen: Wäre Geld ihre einzige oder höchste Triebfeder, wären Sie Banker geworden und würden nicht in Laboren und Bibliotheken arbeiten.
Das postfaktische Zeitalter wird nicht mehr nur durch die Interpretation von Fakten definiert, sondern durch die Definition dessen, was Fakten sind. Das Wort Fakten ist hier entscheidend. Es kommt vom lateinischen Wort facere, was machen, tun bedeutet. Konkret leitet es sich vom Partizip Perfekt Passiv ab, auf Deutsch etwa dem Partizip II vergleichbar und lautet so gemacht. Und so zeigt sich, dass in unserem Wort für eine Tatsache schon klar drin steckt, dass diese darin besteht, das etwas gemacht, erstellt, fabriziert wurde.
Und nach dieser langen Einleitung gehen wir nun über einen kleinen Umweg ins Mittelalter, eine Zeit, in der viele Fakten gemacht wurden. Um diesen Umstand aber richtig würdigen zu können, ist es nötig auch kurz einen Abstecher in die Antike zu machen, denn so unterschiedlich Antike und Mittelalter auch sind, in Bezug auf die Wahrheit sind beide äußerst ambivalent – und das nicht nur im Bereich der Politik. Auch wenn es mit unserem Bild der Antike nur wenig übereinstimmt, war auch diese Zeit voller Wunder, vor allem dann, wenn man sich von der Heimat entfernte. So findet man in einem sonst völlig sachlichem Bericht über den Kriegszug Alexanders des Großen nach Indien die Beschreibung eines Mantikor, eines Tieres mit Skorpionschwanz, Adlerschwingen und dem Kopf und Leib eines Löwen.
Herodot, der als Vater der Geschichtsschreibung gilt, schreibt zwar eigentlich über den Perserkrieg, aber hat in seinen Historien auch viele Beschreibungen eingebaut, die nach Monstern und anderen Ungeheuerlichkeiten klingen. Selbst ein Philosoph wie Platon nutzte Dialoge, in denen er seinen Lehrmeister Sokrates auftreten ließ, um seine Ideen zu verbreiten. Ob diese Gespräche so stattgefunden haben, wie sie aufgeschrieben wurde, ist höchst zweifelhaft. Schon in der Dichtung Homers verschwimmen Wahrheit und Dichtung zu einer unübersichtlichen Menge.
Auf und mit diesem Fundament arbeiten mittelalterliche Autoren. Sie greifen zurück auf Werke in lateinischer Sprache, in denen von den griechischen Geschichten erzählt wird. Von Zwergen, die auf den Schultern von Riesen stehen, spricht John of Salesbury, wenn er von den Menschen der Antike spricht. Das Alte und die Alten gelten im Mittelalter als besser als das, was man jetzt hat, ein Gedanke, den man in der Renaissance dann auch aufgreift. Wenn das Alte aber besser ist, dann ist es auch wahr. Also warum sollte man nicht glauben, was sie schreiben. Und so wimmelt es in der mittelalterlichen Literatur, und damit ist nicht nur die Belletristik, sondern auch alles Geschriebene gemeint, von Mischungen der Wirklichkeit mit der Fiktion. Oder wie es mal ein Philosophieprofessor sagte: In einer Zeit, in der der Glauben bestimmend ist, lässt sich viel einfacher darüber streiten, was die Wahrheit ist. Bis zur Wahl Donald Trumps stritten wir über den Glauben. Gibt es einen Gott? Waren wir auf dem Mond? Aber das waren Spezialdiskurse außerhalb des Mainstreams und dann sorgten diese vielen kleinen Diskurse und ihre Teilnehmer dafür, dass ein Mensch zum Führer der freien Welt wurde, der ernsthaft über Wahrheiten verhandelt.
Also, nun endlich zurück in eine Zeit, in der die Wahrheit Verhandlungssache war. Wenn wir über das Mittelalter und seine Geschichte und Geschichten reden, dann denken wir oft an das Burgfräulein, dass von einem edlen Ritter vor dem bösen Drachen gerettet werden muss.
Woher kommt dieses Topos? Wer von Ihnen gerne alte Kirchen und Kathedralen besucht, wird einen solchen Ritter schon das ein oder andere Mal dort gesehen haben. Es geht dabei um den Hl. Georg, zu dessen Attributen stets der von ihm ermordete Drache gehört. Was hat es damit auf sich?
Die wohl bekannteste Version der Legende stammt aus der Feder von Jacobus de Voragine, die er zusammen mit anderen Heiligenviten in der Legenda aurea niedergeschrieben hat:
„Eines Tages kam [Georg] in eine Stadt in Libyen mit dem Namen Silena. In der Nähe dieser Stadt war ein großer See so groß wie das Meer. Darin befand sich ein unheilbringendes Ungeheuer (draco), das schon mehrfach das Volk, das sich zu wehren versuchte, in die Flucht geschlagen hatte und mit seinem Gifthauch alle vergiftete, sobald es sich den Mauern der Stadt näherte. In dieser Zwangslage gaben ihm die Bürger täglich zwei Schafe, um sein Wüten zu mäßigen. Andernfalls rannte es gegen die Stadtmauern an und verpestet die Luft, so dass viele starben. Als dann kaum noch Schafe vorhanden waren […] übergaben sie dem Ungeheuer nur noch ein Schaf zusammen mit einem Menschen. […] Eines Tages kam auch die einzige Tochter des Königs an die Reihe und wurde dem Drachen zugesprochen. […] Der König kleidete sie in königliche Gewänder und umarmte sie […]. Dann küsste er und ließ sie gehen. […] Der heilige Georg kam zufällig durch diese Gegend und sah sie weinen. Er fragte sie, was sie denn habe. […] Sie erzählte ihm die ganze Geschichte. Georg sagte darauf: ,Meine Tochter, fürchte dich nicht. Denn ich werde dir in Christi Namen helfen.‘ […] Während sie diese Worte wechselten, tauchte das Ungeheuer auf und hob seinen Kopf aus dem See. […] Darauf bestieg Georg sein Pferd, schützte sich mit dem Kreuz und ritt dem Drachen, der auf ihn loskroch, voll Kühnheit entgegen. Mutig schleuderte er seine Lanze und legte sein Schicksal in Gottes Hand. Er verwundete das Untier schwer und streckte es zu Boden. […] Darauf winkte der heilige Georg und rief ihnen zu: ,Fürchtet euch nicht, denn der Herr hat mich zu euch geschickt, um euch vor dem Unheil des Drachen zu befreien. Glaubt nur an Christus; jeder einzelne von euch möge sich taufen lassen, und dann werde ich diesen Drachen töten.‘ Darauf ließen sich der König und das ganze Volk taufen. Der heilige Georg aber zog sein Schwert, töte den Drachen und gab den Befehl, das Untier aus der Stadt zu schaffen.“
In einer Heiligenlegende finden wir schon die Grundlage für die uns bekannte Geschichte vom Ritter, dem Burgfräulein und dem Drachen. Eine solche Legende ist für die Menschen des Mittelalters grundsätzlich wahr. Wahr bedeutet dabei aber nicht, dass die Zahlen, Daten und Fakten stimmen müssen. Es gibt sie ja in dieser Geschichte kaum. Wir wissen nur, dass Gregor sich in einer Stadt namens Silena aufgehalten hat, die irgendwo in Libyen liegt – unendlich weit entfernt für die Menschen des Mittelalters. )Auch für uns heute übrigens. Diese Stadt findet sich auf keiner Karte. Es mag sie heute unter einem anderen Namen geben, aber wo in Nordafrika sie liegt, weiß niemand.) Und dennoch: Für die Menschen des Mittelalters war diese Geschichte wahr. Der Grund dafür liegt einzig in der Tatsache begründet, dass die Tat Georgs und seine Intention wahr sind. In Vertrauen auf Gott und mit der Motivation der Bekehrung der Menschen von Silena zum Christentum, besiegt er den Drachen und rettet die Tochter des Königs. Das ist die Wahrheit der Geschichte und diese wird durch mehr Fakten nicht wahrer.
Weil diese Geschichte aber so gut war, musste der Drache immer mal wieder vorkommen. Der Heilige Columban etwa, der die Schotten zum Christentum bekehrte, fand auch einen Drachen, eine Bestie in einem Fluss namens Ness. Der Fluss mündet in einen See, den man im Schottischen Loch nennt. In der Geschichte des Columban haben wir sogar eine Jahreszahl, wann Columban das Monster von Loch Ness sah: 565. Ort ist klar, Jahr ist klar und bis heute sieht der ein oder andere nach einem Glas Scotch zu viel das Ungeheuer auftauchen. Wahrheit? Das Ungeheuer von Loch Ness ist natürlich wahr. Als kulturhistorisches, wirtschaftsförderndes Phänomen ist es echt, als Lebewesen im See, das zeigen zahlreiche Untersuchungen, ist es das nicht.
Wer Gutes tun will, der muss dies dadurch zeigen, dass er Drachen bekämpft und Ungeheuer besiegt. Auch das deutsche Nationalepos von den Nibelungen hat einen Drachen. Allerdings nur am Rande. Das Epos selber hat gar keine Darstellung des bekannten Kampfes zwischen Siegfried und dem Lindwurm, nur Hagen von Tronje weiß Gunther zu berichten, dass Siegfried den Drachen erschlug:
„Noch eine Mär weiß ich, die ist mir wohl bekannt: //Einen Linddrachen erschlug des Helden Hand // dann badet er in dem Blute. So ward dem Recken wert // die Haut von solcher Härte, dass keine Waffe sie versehrt“.
Welche Kraft eine Erzählung im Mittelalter hatte, wird hier deutlich. Ein Vertrauter erzählt die Geschichte und damit wird sie wahr. So entsteht Wahrheit. Nicht was erzählt wird, ist entscheidend, sondern, wer es erzählt. Wahrheit entsteht durch Status, nicht durch Fakten. Das ist übrigens heute oft noch so. In jüngster Zeit wurde dies am Beispiel des Kunstmarktes ad absurdum geführt, als der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi es schaffte, seine Fälschungen von Kunstexperten als Originale ausgeben zu lassen. Im Deutschunterricht wird unseren Kindern als eines von drei Argumententypen das Autoritätsargument näher gebracht. Was anderes ist das als ein Beleg dafür, dass noch immer das Wer oftmals entscheidender ist, als das Was? Das Mittelalter stand zu diesem Ansatz, Wahrheit zu erkennen.
Er wurde exzessiv in allen Bereichen genutzt. Weil das Alte als besonders Wertvoll galt, war alles, was alt war auch wahr. Geschichtsschreibung und Kanzeleiarbeit war daher für die mittelalterliche Politik ganz entscheidend, etwa dann wenn es darum ging, Herrschaft, die umstritten war, zu legitimieren. Heinrich II. von England ging dabei besonders weit. Was aber war sein Problem? Er war der Enkel von Wilhelm der Eroberer, jenem französisch sprechenden Herzog der Normandie, der 1077 bei Hastings die Angelsachsen vernichtend geschlagen hatte, ihren König Harold absetzte und so König der Engländer wurde. Sein Sohn Wilhelm Rufus folgte ihm nach, verstarb aber ohne Kinder, so dass der jüngere Sohn, Heinrich I., an die Macht kam. Als dieser starb, wollte er seine Tochter Matilda als Erbin eingesetzt wissen, doch die Barone, die dafür zuständig waren, waren einer Frau gegenüber skeptisch und so baten sie Stephan, einen Enkel Wilhelm des Eroberers, den Thron zu besteigen. Was folgte war ein Bürgerkrieg, der in der englischen Geschichtsschreibung als The Anarchy bekannt wurde. Dieser Krieg kannte keinen Gewinner. Stephan blieb im Amt, setzte aber als seinen Erben Heinrich, den Sohn Matildas, ein. Heinrich II. war demnach also König durch seine Mutter, sein Vater war Herzog von Anjou, was ihn zu einem Gegner der Herzöge der Normandie und ihrer Verbündeten machte, auch wenn er diesen Titel als Erbe Stephans innehatte und zudem aus einem Bürgerkrieg auf den Thron gelangt. Das alles war eine Bürde, die der König auf verschiedene Arten zu meistern hatte. Neben politischem Erfolg durch Verwaltungsreformen und Eroberungen in Wales, Schottland und Irland, nutzte er auch die Geschichtsschreibung zu seinen Gunsten und beauftragte den walischen Autoren Geoffrey von Monmouth mit einem Werk über britische Geschichte, in der zum ersten Mal eine Figur einem großen Publikum bekannt gemacht wurde, die bis heute Filme, Fernsehserien und Romane beeinflusst: König Artus!
Dieser sagenhafte König gehört, bedingt durch eine breite popkulturelle Rezeption wohl zu den bekanntesten Königen des Mittelalters. Man weiß von seiner Tafelrunde, in der er als König gleich berechtigt am Tisch saß, ohne dass die Unterschiede durch die formale Sitzordnung, die im Mittelalter üblich war, ausgedrückt wurden. Man weiß von seiner Frau Guinevere, die ihn mit dem Ritter Lancelot betrog. Man weiß von seinem Berater Merlin, dem mächtigen Zauberer, der Stonehenge erschaffen haben soll. Man weiß von der Fee Morgana, seiner mystischen Gegenspielerin, die den sterbenden Artus dann aber auf ihrer Insel Avalon aufnimmt, wo er wartet, bis England wieder gebraucht wird. Man weiß, dass dieses Avalon die alte Abtei von Glastonbury ist, wo sich das Grab des Königs befindet. Man weiß, dass Artus zwar der Sohn von König Uther Pandragon war, aber nur König wurde, weil er das Schwert aus dem Stein ziehen konnte. Man weiß, dass die Burg Artus‘ Camelot hieß und dass diese im heutigen Wales liegt. Das alles weiß man doch, oder zumindest so ein bisschen. Was man nicht weiß ist, wann Artus lebte, wer seine Kinder waren, welche Politik er in Friedenszeiten betrieb und vieles mehr, wie es nun mal mit sagenumwobenen Figuren so ist.
Geoffrey von Monmouth schrieb zu dem oben Skizzierten reichlich wenig. Die Geschichte seines Königs Artus sieht ganz anders aus. In seinem Geschichtswerk nimmt Artus zwar einen großen Teil ein, kommt aber erst recht spät überhaupt vor. Zunächst schreibt Geoffrey von Brutus, einem der Helden von Troja, den es nach Britannien verschlägt, das zu diesem Zeitpunkt aber noch Albion heißt. Dann folgen die Zeit vor den Römern, die Zeit mit den Römern und ein breiter Fokus liegt auf dem Haus König Konstantins, dem zwei Kapitel gewidmet sind. Unterbrochen werden diese Kapitel von einem sehr merkwürdigem Einschub, der die Prophezeiungen Merlins genannt wird.
Dieser Merlin wird als Kind im ersten Kapitel über das Haus Konstantins eingeführt. Die Ausgangssituation beschreibt das Eindringen der Angelsachsen, gegen das die Briten recht chancenlos kämpfen. In seiner Not wendet sich König Vortigern, ein Usurpator auf dem britischen Thron, an seine Magier. Diese sagen ihm, er müsse Ausschau halten nach einem vaterlosen Kind. Der König lässt daraufhin seine Ritter ausschwärmen und sie werden fündig. Das Kind heißt Merlin, seine Mutter ist von königlichem Blut, aber sein Vater unbekannt. Merlin zeigt sein erstaunliches Talent der Prophezeiung vor dem König, dann bricht das Kapitel ab und Geoffrey fügt einzelne Prophezeien des Zauberers ein. Mit viel Schmuckwerk sagt Merlin die Zukunft Englands hervor. Dabei ist eine Sache entscheidend. Diese Prophezeiungen werden im 12. Jahrhundert aufgeschrieben, werden aber von Merlin zurzeit der Völkerwanderung, also etwa im 6./7. Jahrhundert, ausgesprochen. Der Leser von Geoffreys Geschichte konnte also in der Rückschau schon viele der Vorhersagen, in denen Drachen, Wölfe, Schlangen und Löwen für Menschen, Länder und Könige stehen, bestimmten historischen Ereignissen zuschreiben. Am deutlichsten ist dabei sicherlich der Sieg des weißen Drachen, der die Sachsen repräsentiert, über die Briten, dargestellt durch einen roten Drachen.
Ich erinnere hier noch einmal daran. Das was ich hier zusammenfasse ist kein Roman, kein astrologisches Zukunftswerk. Das Werk will Geschichte aufschreiben, also darstellen, was war und doch erfindet Geoffrey hier eine Vergangenheit, in der schon die Zukunft klar erkennbar ist.
Nach den Prophezeihungen Merlin setzt Geoffrey sein Werk über das Haus Konstantins fort und so erfahren wir vom Tod des Usurpators, von der Herrschaft des Königs Aurelius Ambrosius, Konstantins Sohn, von der Errichtung Stonehenges durch Merlin, von der Thronbesteigung Uther Pendragon, Artus Vater, der nach dem Tod seines Bruders König wird. Geoffrey beschreibt darin auch die Nacht, in der Artus gezeugt wurde. Uther Pendragon hatte sich nämlich in Ygerna verliebt, die Frau des Herzogs von Cornwall. Um mit dieser schlafen zu können, begann er einen Krieg mit dem Herzog, doch dieser suchte nicht die offene Schlacht, sondern zog sich und seine Armee in die Burgen zurück, bis die erwarte Hilfe aus Irland eintreffen sollte. Seine Frau brachte er in der Burg Tintagel unter, wo er sie sicher wähnte. Aber Uther erfuhr davon und fragte Merlin, was zu tun sei. Merlin änderte daraufhin das Aussehen des Königs in das des Herzogs von Cornwall und schmuggelte ihn in die Burg. Hier endlich konnte Uther sein Verlangen nach Ygerna, der schönsten Frau im Königreich, stillen. Ihr Mann starb dann doch noch in der Schlacht und Uther heiratete Ygerna. Sie hatten zwei Kinder, Artus und Anna. Als dieser sympathische König vergiftet wird, folgt ihm sein Sohn auf den Thron und damit beginnt ein wilder Ritt durch eine Geschichte Europas, die so nie stattgefunden hat. Zunächst bekämpft Artus alle Angelsachsen und siegt in jeder Schlacht, dann kämpft er gegen die Picten in Schottland, denn diese hatten immerhin seinen Großvater umgebracht. Über die Nordsee kommt er nach Skandinavien und erobert Norwegen und Dänemark, danach geht es weiter nach Gallien, das er selbstredend auch erobert. So zieht er natürlich den Ärger des römischen Reichs auf sich, das sich schon wundert, wo eigentlich die Tributzahlungen aus Britannien bleiben. Artus will aber nicht mehr zahlen und es kommt wie es kommen muss: Die Armeen Roms und die Armeen Artus‘ treffen aufeinander. Bevor es jedoch zur alles entscheidenden Schlacht kommt, die Artus natürlich gewinnt, tötet Artus noch zwischendurch den Riesen von Mont Saint Michelle. Artus könnte als Sieger zurück nach Britannien ziehen, doch da passiert ein Verrat zu Hause: Der Reichsverweser in Britannien, Modred, Artus‘ Neffe, nutzte die Gelegenheit, um sich selbst zum König von England zu krönen. Nun kämpfen die Heere Artus‘ und Modreds gegeneinander. In der Schlacht von Camblan stirbt der Verräter Modred, doch auch Artus wird tödlich verwundet und wird nach Avalon gebracht. Sein Nachfolger wird Konstantin, sein Vetter. Und plötzlich steht bei Geoffrey auch eine Jahreszahl: 542 ist das Todesjahr von König Artus.
Seien Sie ehrlich: Sie wussten nicht, dass Großbritannien im frühen 6. Jahrhundert mal über Halbeuropa herrschte und die Reste des Römischen Reichs geschlagen hatte, um keinen Tribut mehr zahlen zu müssen. So steht es bei Geoffrey – und leider bei keinem anderen Geschichtsschreiber. Pure Fantasie. Es gibt natürlich irgendwo immer einen wahren Kern. Das ist ja das Gemeine am Postfaktischen. Die Orte, die Geoffrey beschreibt sind fast alle echt. Auch verschiedene Menschen, die er auftreten lässt, haben tatsächlich existiert und doch spinnt er sich einen Text zusammen, der ihn zu einem der größten Lügner der Geschichtsschreibung macht. Auch Artus hat wahrscheinlich existiert, denn Geoffrey hat ihn nicht erfunden. Andere Werke, die älter sind als die Geschichte der britischen Könige aus Geoffreys Hand kennen ihn. Zwei Journalisten haben sich die Mühe gemacht und alle möglichen Quellen abgeklopft und miteinander verglichen. Sie sind vor über 30 Jahren zu der Erkenntnis gelangt, dass Artus ein Anführer aus Wales gewesen sein muss, der den Namen Owain Ddantgwyn trug.
Doch was hilft es, das zu wissen? Eventuell ist es ein Fakt, dass Artus Owain Ddantgwyn war, doch die Geschichte von Geoffrey liest sich besser. Diese Geschichte bildet die Grundlage für Chretien de Troyes, Hartmann von Aue oder Wolfram von Eschenbach Artus-Romane zu schreiben. So wird eine unbelegte, definitiv erlogene Geschichte zu einem kulturhistorischem Faktum, ohne real zu sein. Der Wunsch eines Königs sich zu etablieren, in dem er Geschichte fälschen ließ, um zu zeigen, welche Macht von diesem Großbritannien ausgeht, ganz egal, wer auf dem Thron sitzt. Denn das Kapitel von Artus ist nicht das letzte Kapitel in Geoffreys Buch. Es folgt noch eines über die Herrschaft der Sachsen, die, obwohl die ganze Zeit bekämpft, schließlich doch zu wahren Briten werden, die das Land hegen, pflegen und weise regieren.
Geoffrey gilt aufgrund der nachweislich erfunden Geschichten als nicht besonders glaubwürdig. Um noch einmal einen Vergleich zu heute zu ziehen. Geoffreys Werk ist etwa vergleichbar mit den Boulevardmedien von heute. Presseerzeugnisse, in denen Stars und Adeligen Affären, Kinder oder Krankheiten angedichtet werden, die in der nächsten Woche schon wieder vergessen sind. Immer wieder werden solche Medien angeprangert. Wenn man diese in der Tat lügende Presse aber gleichsetzt mit ihren seriösen Kollegen, dann wird oftmals angeführt, seriöse Zeitschriften, Zeitungen und Nachrichtensendungen würden überprüft und arbeiteten generell sauberer und ehrlicher. Und doch: Ab und an zeigt sich auch dort, dass Dinge verharmlost, weggelassen, oder wie im Fall Relotius beim Spiegel, erfunden werden. Auch das ist nicht neu. Das Mittelalter hat auch solche seriösen Geschichtsschreiber hervorgebracht. Ihre Werke gelten als zuverlässig, aber an der ein oder anderen Stelle, passieren dann doch grobe Schnitzer.
Daneben existieren Werke, die von ihrer schriftstellerischen Qualität einfach nur schlecht sind. Auch so etwas kennt man in der heutigen Presselandschaft. Dort, wo zwar noch Regionalzeitungen erscheinen, aber diese von unterbezahlten freien Mitarbeitern mit Artikeln bestückt werden, erkennen sich Interviewte in den entsprechenden Artikeln nicht wieder oder Pressemitteilungen und Meldungen der Agenturen sind falsch abgeschrieben worden. Ein solches Machwerk soll im Fokus des nächsten Abschnitts stehen.
Die Zeit der Völkerwanderung ist eine Zeit, die oft als dunkel angesehen wird. Vielleicht ist das der Grund, warum Geoffrey die Möglichkeit sah, seinen heldenhaften König Artus gerade dann auftreten zu lassen. Weil es kaum Quellen zu dieser Zeit des Übergangs von Antike zu Mittelalter gibt, kann man auch mal ein kurzlebiges britisches Großreich erfinden, das Gegenteil mag eh keiner belegen. Es ist demnach eine Zeit, in der wenig geschrieben wurde, was unser Wissen über diese Zeit enorm einschränkt, mehr noch als das anderer Epochen. Dennoch gibt es Dokumente, sogar die ein oder andere Geschichtsschreibung. Ein Werk ist die Gotengeschichte des Jordanis. Über den Autoren wissen wir nur, was er über sich selbst im Vorwort preisgibt. Das aber ist aller Ehren wert. Jordanis will diese Geschichte gar nicht schreiben, sondern wird dazu von einem Bruder gezwungen, der selber nicht weiß, wie hart diese Arbeit ist. Dabei soll er gar nicht selber schöpferisch tätig werden, sondern lediglich ein großes Werk von zwölf Bänden über die Geschichte der Goten in einem kleinen Büchlein zusammenfassen. Erschwert wird diese Aufgabe dadurch, dass er dieses Großwerk gar nicht zur Verfügung hat, sondern nur eine kurze Gelegenheit von drei Tagen hatte, sie zu lesen. Aber er versichert seinen Lesern, sich an alles genau erinnern zu können. Zudem habe er an der ein oder anderen Stelle noch ein paar andere ihm bekannte Geschichten hinzugefügt. Sollte dennoch etwas fehlen, so Jordanis, dann mag sich der aufmerksame Leser nicht scheuen und selbstständig das Fehlende hinzufügen.
Besser kann man sich wohl kaum vor dem Vorwurf schützen, Fehler gemacht zu haben. Geringe Motivation, aber Pflichtbewusstsein, nur eine gute Erinnerung an das Originalwerk und die Aufforderung, es doch selber besser zu machen, wenn man unzufrieden ist, verpackt in einen sehr zurückhaltenden Stil, mit dem er auch noch kokettiert, denn sein Hauch sei zu schwach, „um die herrliche Posaune jenes Mannes zu füllen“, der das Originalwerk schrieb. Wie so oft ist es leider so, dass diese zwölf Bände Cassidors zur Geschichte der Goten nicht mehr existieren.
Jordanis ist mit der an ihn angetragenen Aufgabe überfordert. Das zeigt sich schon daran, dass die von mir gerade sinngemäß wiedergegebene Vorrede des Jordanis gar nicht von ihm selber stammt, sondern er sich der Vorrede eines anderen bedient hat. Ein Mann namens Rufinus hatte diese Vorrede zu Beginn seiner Übersetzung eines Kommentars zum biblischen Römerbrief genutzt und Jordanis sie nahezu Wort für Wort übernommen.
Jordanis übernimmt aber nicht nur die Vorworte anderer, er ist in seiner Darstellung absolut parteiisch.Er möchte aufzeigen, wie gut das Volk der Goten sich in das Römische Reich integriert hat. Zu diesem Zweck lässt er den Gotenkönig Theoderich, der als Dietrich von Bern nicht nur im Nibelungenlied literarisch mehr Abenteuer erlebte als seine historische Vorlage, immer einen Freund des oströmischen Kaisers sein, obwohl dieser die feindliche Annektion Italiens mehr als nicht gut hieß. Um aber nicht ganz die Wahrheit zu verleugnen, bedient sich Jordanis eines Tricks. Um die zwischen Römern und Goten bestehenden Animositäten zu erklären, braucht er einen Sündenbock und findet diesen in Attila, dem Hunnenkönig, der durch Briefe und schöne Rede Goten und Römer voneinander trennen möchte. Die List Attilas aber geht nicht auf und stattdessen verbinden sich Römer und Goten. Bei der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern wird Attila schließlich besiegt. Das entspricht in der Tat der historischen Wirklichkeit, die Briefe Attilas, sowie das Bündnis der Römer und Goten, das mitnichten eines der Freundschaft, wie Jordanis es darstellt, war, sondern eines des Zwecks, um die große Gefahr der Hunnen abzuwehren, tun es nicht.
Jordanis ist sicherlich keiner der großen Geschichtsschreiber, aber auch seine Stimme hatte in gewissen Kreisen Gewicht. Seine Zusammenfassung ist, anders als das Originalwerk, überliefert, was ein Hinweis darauf ist, dass sein Büchlein verbreiterter war, als die großen Standardwerke. Wer seinen Einfluss nutzt, um mit Geschichte Politik zu machen, darf nicht unterschätzt werden.
Was aber ist nun mit den großen, ernstzunehmenden Geschichtsschreibern des Mittelalters, den bekannten Namen wie Widukind von Corvey oder Otto von Freising? Wie sieht es mit ihnen aus? Alles wahr, alles ungetrübte sachliche Berichterstattung? Natürlich nicht!
Widukind von Corvey etwa, dem wir ein Geschichtswerk über die Sachsen verdanken und darin vor allem auch über die Ottonischen Kaiser des frühen Mittelalters, ist ein ausgesprochener Lokalpatriot. Das sächsische Volk geht ihm dabei über alles und daher wird auch ein Kaiser mal für eine Politik kritisiert, die in den Augen des Historikers Widukind falsch war. Dazu greift er auf einen auch heute noch beliebten Kniff zurück. Er erwähnt bestimmte Dinge gar nicht, oder nur oberflächlich:
„Also, wie [der Kaiser] den Langobardenkönig Berengar, nachdem er ihn zwei Jahre lang belagert hatte, samt Frau und Töchterngefangengenommen und in die Verbannung geschickt, die Römer in zwei Schlachten besiegt und Rom erobert hat, wie er die Herzöge der Beneventaner unterworfen, die Griechen in Calabrien und Apulien überwunden, wie er in Sachsen die Silberadern erschlossen und wie großartig er das Reich mit seinem Sohn ausgedehnt hat, das zu erzählen vermögen wir nicht“.
Über zwei Jahre Kaisergeschichte werden hier von Widukind einfach in einem Abschnitt seines dreibändigen Werkes zusammengefasst. Nicht nur das. Er vergisst ein kleines, unwesentliches Detail in seiner Auflistung: die Kaiserkrönung Ottos I. im Jahr 962. Diese hatte Widukind zwar nicht persönlich miterlebt, aber als Zeitgenosse Ottos und gut informierter Geschichtsschreiber wusste er von diesem Ereignis. Das Verschweigen dieses Umstands hat also eine politische Bedeutung. Diese liegt klar darin begründet, dass er zwar nicht ohne stolz auf Otto blickt, der als erster Sachsenkönig auch Deutscher König wird, aber die Italienpolitik des Kaisers ist ihm nicht geheuer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Aspekt von Widukinds Geschichte auf einer Antipathie des Papsttums beruht. Der Papst kommt in der Geschichte so gut wie gar nicht vor, höchste geistliche Autoritäten sind die Erzbischöfe von Mainz und Köln. Auf den ersten Blick mag das verwundern, da Widukind ja selbst Kleriker ist, der im Kloster Corvey wirkt, aber auf den zweiten Blick ergibt dies durchaus Sinn, denn bis heute existiert in der katholischen Kirche ja ein Gegensatz zwischen der Macht des Papstes auf der einen Seite und der Macht der Kardinäle auf der anderen. Widukind ist auf Seiten der Kardinäle und sieht im Papst daher lediglich einen Bischof unter vielen, wenn auch in einer herausragenden Position als Nachfolger Petri, nicht aber als Oberhaupt der Kirche. Dass der Papst sich als solches zudem in weltliche Politik einmischt, in dem er den Kaiser krönt, passt dem sächsischen Patrioten gar nicht. So lässt er diese Begebenheit einfach weg, was auch gut in seine Geschichte des sächsischen Volkes und eben nicht des sächsischen Königs passt. Diesen mag er aber trotzdem und auch als Kaiser schätzt ihr ihn. Die Krönung durch den Papst ist es, was ihn stört. So legitimiert Widukind den Kaiser in seinem Werk schon vor der eigentlichen Krönung, durch den Sieg bei der Schlacht auf dem Amselfeld, der dort auch von den sächsischen Truppen zum imperator ausgerufen wird.
Von eine ganz andere Schlacht berichtet der Geschichtsschreiber Otto von Freising, einer der unumstößlichen Heroen mittelalterlichen Schrifttums, einer der seriösesten Historiker. Seine Chronik gilt als ein Höhepunkt der Schriftkultur, aber auch er kommt nicht ohne postfaktisches Auftreten auf. Die erwähnte Schlacht ist dabei entscheidend. In dieser, so schreibt Otto,
„habe ein gewisser Johannes, ein König und Priester, der im äußersten Orient, jenseits von Persien und Armenien wohne und wie sein Volk Christ, aber Nestorianer sei, zwei Brüder, die Könige der Perser und Meder, Samiarden genannt, angegriffen und ihre Hauptstadt […] Ekbatana erobert. Als sich ihm dann die beiden Könige mit den Streitkräften der Perser, Meder und Assyrer zum Kampf stellten, wurden drei Tage gekämpft, da beide Gegner lieber sterben als fliehen wollten. Dann endlich wandten sich die Perser zur Flucht, und der Presbyter Johannes […] ging aus dem blutigen Gemetzel als Sieger hervor. Nach dem Siege […] unternahm Johannes einen Feldzug, um der Kirche von Jerusalem zu Hilfe zu kommen, als er aber an den Tigris kam und nicht ein einziges Schiff vorfand, um sein Heer überzusetzen, marschierte er nach Norden ab, wo, wie er gehört hatte, der Strom in der Winterkälte zufror. Dort hielt er sich einige Jahre auf und wartete auf Frost, aber infolge der milden Temperaturen kam keiner, und da sein Heer durch das ungewohnte Klima schwere Verluste erlitt, sah er sich genötigt, in sein Land zurückzukehren. Er soll dem alten Geschlecht der Magier entsprossen sein, die im Evangelium erwähnt werden, und als Herrscher über dieselben Völker wie jene solchen Ruhm und Überfluss genießen, daß er sich nur eines smaragdenen Szepters bediene. Durch seine Vorfahren Beispiel also begeistert, die kamen, Christus in den Windeln anzubeten, hatte er sich vorgenommen, nach Jerusalem zu ziehen, und man versichert, nur aus dem angegebenen Grunde sei er daran gehindert worden“.
Starker Tobak für ein Werk, das als Höhepunkt der mittelalterlichen Geschichtsschreibung gilt. Mitten in den Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen im Zeitalter der Kreuzzüge berichtet Otto Mitte des 12. Jahrhunderts von einem christlichen König, der die Muslime von Osten kommend angreift und vernichtend schlägt. Bevor er aber Jerusalem erreichen kann, kehrt er um, weil der Tigris ihm einen Strich durch die Rechnung macht und nicht zufrieren will.
Eine nette Geschichte, die Otto erzählt, ein Gerücht, das ihm von Kreuzrittern weitererzählt wurde, die im aussichtslosen Kampf gegen die Muslime jeden Strohhalm greifen, den sie zur Motivation nehmen können.
Aus dieser Passage wird die Sehnsucht nach einem heldenhaften Retter vor der muslimischen Gefahr, die durch zahlreiche andere Berichte ergänzt wird. Im Laufe des Mittelalters taucht ein Brief des Johannes auf, eine klare Fälschung. Sein Reich wird durch Ritter bereist, die in Reiseberichten davon schreiben, wie großartig es dort sei. Die Hoffnung, dieses Reich zu finden, treibt unter anderem noch Heinrich den Seefahrer an, als er die Westküste Afrikas erkunden lässt und selbst Vasco da Gama glaubt beim ersten Anblick von Hindus daran, endlich das Reich des Johannes‘ gefunden zu haben. Doch dieses Reich existierte nicht. Es war eine Wunschvorstellung, die sich aus dem Halbwissen um die äthiopischen Könige, den durch Muslime weitergetragenen Klatsch aus Indien und im Spätmittelalter schließlich durch die Beschreibungen Chinas durch Marco Polo und anderen speiste. Ihren Anfang aber nahm sie bei Otto von Freising. Wirkmächtiger konnte ein alternatives Faktum kaum sein.
Nun könnte man sagen: Okay, das waren jetzt sicher schöne Geschichten und die Autoren haben hier einfach mal so getan, als ob diese tatsächlich so passiert wären, alle Welt hat es geglaubt, aber das hatte ja, etwa im Fall von Geoffrey von Monmouth, bis auf ein paar schöne Romane und später Filme kaum Auswirkungen auf die Wirklichkeit. Langfristig gesehen hätte man da recht, aber in der Zeit, in der die Autoren schrieben und im Falle Otto von Freisings sogar über Jahrhunderte später, waren diese Auswirkungen definitiv spürbar.
Aber Sie möchten eine Lüge aus dem Mittelalter, die länger Bestand hat? Eventuell sogar bis heute oder zumindest bis ins 20. Jahrhundert? Das gibt es auch. Begleiten Sie mich in die wunderbare Welt des Vatikans und die große Lüge der Konstantinischen Schenkung.
Wir gehen dafür zunächst zurück in die Antike, jene Zeit, die später von Humanisten der Renaissance zum goldenen Zeitalter des Guten, Wahren und Schönen verklärt wurde. Genauer in die Zeit des römischen Kaisers Konstantin, dem Gründer Konstantinopels, einem der letzten großen und bedeutender Kaiser des Römischen Reichs, der 337 starb. Dieser Kaiser nun war dem Christentum gegenüber alles andere als positiv eingestellt. Das gefiel Gott gar nicht und so strafte er den Kaiser mit einem Aussatz, der ihn unfähig machte, seinen Amtsgeschäften nachzugehen oder auch nur das Leben zu genießen. Konstantin probierte alles möglich, was die römische Medizin und Religion zu bieten hatte, aus.
Da alles ohne Ergebnis blieb, schritt er zu einer Maßnahme, die selbst in den Augen der Römer kaum machbar war. Seine Priester rieten ihm, er solle im Blut unschuldiger Kinder baden. Diese wurden zusammen getrieben und kurz bevor es zum Massenmord an der Schar gekommen wäre, sah Konstantin ein, dass dieser Vorgang nicht lohne und er ließ die Kinder wieder frei. Dieser Akt der Reue, in denen er das Wohl der Kinder über sein eigenes stellte, war der Moment, in dem er eine Vision von Petrus und Paul hatte. Sie erschienen ihm im Traum und sagten ihm, er solle Papst Silvester holen, der sich vor der Christenverfolgung unter Konstantin versteckt hielt. Dieser würde ihm vom Aufsatz heilen können.
Konstantin lies nach dem Papst suchen, sicherte ihm freies Geleit zu und als der Papst zu ihm kam, lies er sich taufen. Durch dieses Sakrament verlor der Kaiser seinen Aussatz und war fortan so glücklich, dass er auf dem Sterbebett dem Papst und allen seinen Nachfolgern nicht nur die Stadt Rom unterstellte, sondern ganz Italien und auch die Oberaufsicht über das gesamte Weströmische Reich.
Das ist in etwa der Inhalt einer Urkunde, die auf die Zeit der 330er Jahre datiert wird. Die nette Geschichte mit dem reumütigen Kaiser ist natürlich zu schön, um wahr zu sein, sie ist aber sogar zu schön für die Heiligenvita Papst Silvesters, in der sie eben nicht vorkommt. Hinzu kommt, dass recht klar belegt ist, dass Kaiser Konstantin durch Bischof Eusebios von Nikomedia auf dem Sterbebett getauft wurde.
Für uns heute ist also relativ eindeutig, dass das Dokument eine Fälschung ist. Für die Menschen des Mittelalters war das nur bedingt so. Wann diese Fälschung entstanden ist, ist nicht ganz klar. Die älteste Handschrift stammt aus der Mitte des 9. Jahrhunderts und findet sich in den Dekretalen eines Autoren, den wir nicht kennen, der sich aber als Isidor von Sevilla, der erste große Enzyklopädist des Mittelalters ausgibt. Daher hat ihn die Forschung den Namen Pseudo-Isidor gegeben. Dessen Dekretalen, bei denen es sich um rechtskräftige Papstbriefe handelt, sind allesamt gefälscht, dennoch geht die Forschung davon aus, dass die Schenkungsurkunde nicht extra für dieses Werk erdacht wurde, sondern bereits früher vorhanden war. So wird der Entstehungsraum in die Zeit zwischen 750 und 850 vermutet. Diese Überlegung geht auf Stil und Formulierungen in der Schenkung zurück, die mit den restlichen Texten nicht übereinstimmen. Als Autor wird allgemein ein römischer Kleriker angenommen, doch auch das ist nicht sicher.
Interessant ist im Aufbau der Urkunde vor allem eines: Die Schenkung des Weströmischen Reichs ist Teil einer Liste von Dingen, die der Kaiser auf den Papst überträgt – und steht auf dem letzten Platz. Viel wichtiger sind dem Autor die folgenden Dinge:
„das Diadem, das heißt die Krone unseres Hauptes, zusammen mit der Paradehaube und dem Gürtel, das heißt mit dem Schulterkleid, das üblicherweise den kaiserlichen Hals umgibt; außerdem aber auch den Purpurmantel und die scharlachrote Tunika und alle kaiserlichen Ehrenzeichen; ferner die Würde, die kaiserlichen Reiter zu befehligen, und die kaiserlichen Szepter, Waffen und Zeichen; außerdem die Fahnen und verschiedene kaiserliche Ehrenzeichen, und [damit] den gesamten Aufzug kaiserlicher Macht und die Ehre unserer Amtsgewalt.“
Erst danach kommt ein folgenschwerer Satz:
„Daher haben wir die Entscheidung gefällt: Damit die priesterliche Krone nicht wertlos werde, sondern vielmehr an Würde und Macht des Ruhmes die irdische Kaisermacht überragt, übergeben wir, wie beschrieben wurde, sowohl unseren Palast als auch die Provinzen, Orte und Städte der Stadt Rom, Italiens bzw. aller westlichen Gegenden an den oft genannten, sehr seligen Priester, unseren Vater Silvester, den allgemeinen Papst. Wir überlassen es aber durch unsere heilige, göttliche und pragmatische Anordnung der Amtsgewalt und dem Machtbereich der Priester, die [Silvester] nachfolgen, dass [beides] nach strenger kaiserlicher Überprüfung geordnet und dem Recht der heiligen römische Kirche unterstellt werde. Dieses haben wir ihnen zugestanden.“
Es ist schon eine seltsame Formulierung, die dort gewählt wurde. Dem Papst werden Rom und Italien vermacht, aber auch alle westlichen Gegenden. Diese Formulierung hat innerhalb der Forschung zu mancherlei Überlegungen geführt. Man geht davon aus, dass der Grund für diese Formulierung in der Zeit der Entstehung zu finden ist. Italien ist zu diesem Zeitpunkt gespalten. Im Norden sitzen die Langobarden, der südliche Teil ist griechisch dominiert. Die Vorherrschaft beider aber brökelt und so wird probiert, der Kirche, die seit dem Fall des Römischen Reichs die einzige konstante Verwaltungsmacht in Rom darstellt, die Macht über Italien zu übertragen. Um das zu erreichen, wird eine Urkunde gefälscht, die auf einen der letzten großen Kaiser zurückgeht.
Für uns aber ist entscheidend: Ging der Plan auf? Es gibt Spuren, die die Konstantinische Schenkung als Quelle in Argumentationen der Päpste gegenüber den Kaisern bis zum Jahre 1000 anführen, doch so richtig berühmt wird die Urkunde erst im 11. Jahrhundert, als Papst Leo IX. sie explizit einsetzt, um auf das päpstliche Primat gegenüber Kaiser und Bischöfen hinzuweisen. Von da an kommt die Schenkung Konstantins immer wieder auf, vor allem unter Papst Innozenz III., der den Kirchenstaat stark ausbaut und auch vor militärischen Manövern nicht zurückschreckt, um die politische Macht des Papstes zu stärken.
Angezweifelt wird die Schenkung dabei selten. Als einziger Kaiser des Mittelalters ist es Otto III., der den Inhalt ablehnt, alle anderen glauben daran, probieren aber dennoch die Schenkung an der ein oder anderen Stelle zu umgehen oder umzuinterpretieren.
Als Fälschung erkannt wird die Urkunde erst durch den Begründer der Textkritik Lorenzo Valla, der 1440 dazu ein Werk veröffentlichte. Schon sieben Jahre vorher hatte der mittelalterliche Philosoph Nikolaus von Kues auf die Unechtheit der Urkunde aufmerksam gemacht. Doch in breiten Kreisen blieben diesen Vorwürfe unbekannt, auch wenn in Rom zu Zeiten Kaiser Barbarossas angeblich über diese Fälschung getrascht worden sein soll. Auch Bernhard von Clairvaux, der große Zisternzenser und Kritiker kirchlichen Prunks, sah in dem Dokument eine Fälschung. Aber erst durch Martin Luther bekamen diese Erkenntnisse eine große Popularität, so dass sich die Kirche dazu verhalten musste. Ihre Reaktion war keine Überraschung. Die Urkunde sei zwar gefälscht, das ändere aber nichts daran, dass der Inhalt der Wahrheit entspräche. Bis zum späten 19. Jahrhundert argumentierte die Kurie so. Urheber der Fälschung sie nach Aussage der römischen Kleriker auch die griechische Kirche. Dort hatte die Schenkungsurkunde tatsächlich einen heiligen Charakter bekommen. Doch eine Untersuchung zeigte klar, dass der griechische Text auf der lateinischen Fassung beruhte, nicht anders herum.
Und heute? Die Schenkung hatte über die Jahrzehnte längst Fakten geschaffen, die weit wirkmächtiger sind, als das Dokument selber. Denken wir etwa an das kaiserliche Purpur, dass Kardinäle heute wie selbstverständlich tragen, oder die Prozessionen, die von katholischer Seite zu bestimmten Feiertagen veranstaltet werden. Durch die Schenkung Kaiser Konstantins wurde dieses legitimiert. Ähnliches gilt für den Vatikanstaat, der in seiner heutigen Form ja nur existiert, weil sich Mussolini mit Papst Pius XI. 1929 darauf einigte, dass die bei den italienischen Einigungskriegen besetzten Gebiete des Kirchenstaates auch von päpstlicher Seite als Teil des Königreichs Italien anerkannt wurden. Mit der Ausnahme der 0,44 qkm, die heute den Staat der Vatikanstadt ausmachen. Dazu wurden finanzielle Ausgleichszahlungen vereinbart, die die Grundlagen für die Vatikanbank legten.
Eine Fälschung aus dem 8. Jahrhundert war so wirkmächtig, dass sie Fakten schuf, die selber nicht mehr geändert werden konnten. Unsere Reise durch das postfaktische Zeitalter des Mittelalters soll an dieser Stelle beendet werden. Ich hoffe sie hat gezeigt, wie lange dieses neue Zeitalter des Postfaktischen bereits existiert und dass auch alternative Fakten, wenn man lange daran glaubt, zu echten Fakten werden können.
Leicht überarbeitete Fassung eines Vortrags an der Bergischen Volkshochschule am 13. August 2020.